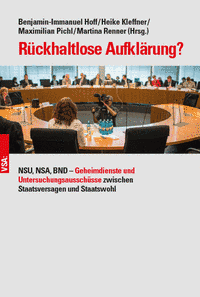Rot-rot-grün in der Bundeshauptstadt - Ergebnisse der Berlin-Wahlen
Wahlnachtbericht und erste Analyse von Benjamin-Immanuel und Alexander Fischer
Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus dem Wahlnachtbericht, der unter dem untenstehenden PDF-Dokumenten in Gänze eingesehen werden kann. Er wurde gemeinsam verfasst mit Alexander Fischer, zwischen 2014 und 2015 Regierungssprecher der Thüringer Landesregierung und seitdem Referatsleiter in der Landesvertretung des Freistaates beim Bund. Beide Autoren geben ausschließlich ihre persönliche Meinung wieder.
Die politische Grundstimmung: Failed City Berlin
Das Ergebnis der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus (AGH) und den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) ist zum einen das Resultat landesspezifischer Entwicklungen, zum anderen aber ein weiterer Beleg dafür, dass sich in der Bundesrepublik eine tendenzielle Neuordnung des politischen Feldes und des Parteiensystems vollzieht, die eine Neujustierung der Binnenverhältnisse unter den Parteien nach sich ziehen wird.
Der Berliner Wahlkampf war in der Vorwahlkampfphase eindeutig von landespolitischen Themen dominiert. Die in Umfragen manifeste und seitdem auf hohem Niveau verharrende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Arbeit des Senats korrespondierte mit einer beinahe ausschließlich negativen Berichterstattung in den Medien über die Arbeit des Senats (Stichwort: "Failed Stadt") und einer Stadtgesellschaft, die in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien ihre Unzufriedenheit mit den Zuständen in der Stadt und den wachsenden Zumutungen für ihre Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere in folgenden Themen artikulierte:
- Anhaltende Probleme bei der Flüchtlingsunterbringung in den Jahren 2014/2015
- Verkehrsprobleme, vor allem bei der Berliner S-Bahn,
- Terminchaos in den Bürgerämtern,
- Mietenentwicklung und Gentrifizierung,
- unregulierter Tourismus,
- unsensibler Umgang mit Events im Stadtgebiet,
- über die gesamte Wahlperiode hinweg bestehende Unsicherheit, ob und wann der Berliner Flughafen BER fertiggestellt wird etc.
Hinzu kam, dass es der Koalition aus SPD und CDU über den Zeitraum der vergangenen Wahlperiode nicht gelungen war, Vertrauen in die Fähigkeit zu erzeugen, gemeinsam Probleme zu lösen. Die Koalition war als Notlösung gebildet worden, da SPD und Linkspartei keine Regierungsmehrheit mehr auf sich vereinigen konnten und die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen zum wiederholten Male nicht erfolgreich waren.
Flüchtlingspolitik und LAGeSo als Symbole einer zur Zusammenarbeit unfähigen Koalition
Insbesondere bei der Unterbringung von Flüchtlingen, symbolisiert an der dramatischen Rolle des Berliner Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), zeigten sich die Unterschiede zwischen SPD und CDU in besonders starker Weise. Der christdemokratische Sozialsenator Mario Czaja hatte die Probleme zu lange unterschätzt, im LAGeSo bestanden veritable Steuerungsprobleme und ein zwingend notwendiges ressortübergreifendes Handeln war lange Zeit nicht zu erkennen. Der Sozialsenator wurde jedoch nicht nur von seiner eigenen Partei im Stich gelassen, die – wie Czaja selbst – dem Thema so lange zu wenig Bedeutung zugemessen hatte, bis die Probleme überhandnahmen und den Senat in eine Legitimitätskrise stürzten, da die deutliche Mehrheit der Stadt eine humane Flüchtlingskrise erwartete. Doch auch die SPD, die immerhin die Integrationssenatorin stellte, entzog sich der Verantwortung und ließ seitens des Regierenden Bürgermeisters keine Führungsfähigkeit erkennen. Diese wurde letztlich auf dem Rücken des LAGeSo-Präsidenten, der die Rolle des Bauernopfers zugeschrieben bekam, und in Form einer Distanzierung vom Koalitionspartner und Problemabwälzung zu dessen Lasten, wieder hergestellt.
Die von Anbeginn der rot-schwarzen Koalition schwelenden und seit dem vergangenen Jahr nur noch öffentlichen Streitereien in der Koalition eskalierten im ersten Halbjahr 2016 vollends und wurden zudem zunehmend personalisiert und durch gezielte Indiskretion aus Behörden und Regierungsparteien heraus als Auseinandersetzungen um das Fehlverhalten einzelner Akteur/innen geführt. So die Auseinandersetzungen um den Regierenden Bürgermeister, den Sozialsenator, den Innensenator, den Bausenator, den Chef der Senatskanzlei und die Regierungssprecherin.
Insbesondere der Bausenator Andreas Geisel (SPD), der am Wahlabend seinen Direktwahlkreis gegen den früheren Wirtschaftssenator Harald Wolf (DIE LINKE) verloren hat, machte in den vergangenen Monaten durch Mauscheleien mit Investoren am lukrativen Leipziger Platz negativ von sich reden.
Infratest dimap befragte im April 2016 die Berlinerinnen und Berliner nach Filz und Korruption. Gefragt, ob Filz und Korruption weiter verbreitet seien, antworteten 34%, dass sie diesen Eindruck hätten, während 53% dies verneinten.
Von den Befragten waren 25% der Meinung, dass Klüngeleien und Mauscheleien in der CDU am stärksten verbreitet seien, während 12% dies für die SPD annahmen und 7% andere Parteien nannten. Entscheidender ist, dass 23% meinten, dies sei in allen Parteien gleich verbreitet, während rund ein Drittel (32%) mit weiß nicht antwortete oder keine Angaben machte.
Die Artikel in bundesweiten Zeitungen über eine Stadt, die ihre Chancen verspielt, füllen Regale, und in jeder Satireshow garantiert ein Beitrag über Berlin Lacher – außer in der Stadt selbst, in der dieses Image als nervend empfunden wird.
Das in der politischen Öffentlichkeit gezeichnete Bild von Berlin war und ist das von einer wachsenden und für Zuziehende aus aller Welt attraktiven Stadt, die aber schlecht regiert wird, deren Bürgerinnen und Bürger mit wachsenden Alltagszumutungen zu kämpfen haben, während es kaum Aussicht auf eine Veränderung zum Besseren gibt.
Dass in Berlin viel gebaut werden würde, aber nicht da, wo es am nötigsten sei, meinten 70% der von Infratest dimap Befragten Wahlberechtigten Berlins. Fast ebenso viele (69%) waren der Meinung, dass die Stadt eine unfähige Verwaltung habe. Dies dürfte ziemlich einmalig für eine Stadt dieser Größenordnung sein. Eine Herausforderung jeder neuen Konstellation wird darin bestehen, dass 61% der Auffassung sind, dass egal wer regiert, keine Partei die Probleme in den Griff bekommen würde. Gleichzeitig hat sich – trotz dieser Bewertungen – an der Zufriedenheit mit dem jeweils regierenden Senat nichts geändert.
Ob Große Koalition 1999 (Zufriedenheit: 33%), rot-grüne Minderheitsregierung 2001 (41%), rot-roter Senat 2006 und 2011 (38%) oder nun erneut Große Koalition (36%) mit großer Mehrheit sehen die Stadtbewohner/-innen ihren jeweiligen Senat kritisch.
War das Label „arm aber sexy“ zu Zeiten von Klaus Wowereit noch Ausdruck eines trotzigen Selbstbewusstseins einer von sozialen Verwerfungen und finanzieller Not gebeutelten Hauptstadtgesellschaft, so wird es heute nach wie vor als Ausdruck eines städtischen Lebensgefühls zitiert, erzählt aber immer auch die Geschichte vom Berlin des Jahres 2016, dessen Bürgerinnen und Bürger an ihrer Stadt leiden, weil sie in den für ihre Lebensführung zentralen Bereichen fortgesetzt versagt.
Die wirtschaftliche Lage schätzen die Berliner/-innen – einem bundesweiten Trend folgend – in den vergangenen Jahren zunehmend besser ein. Bewerteten 1999 noch 77% der von Infratest dimap Befragten die wirtschaftliche Lage als schlecht (gut: 22%) ein und nahm die negative Bewertung bei den Wahlen 2001 (schlecht: 86%, gut: 13%) und 2006 (schlecht: 85%, gut: 14%) noch zu, sank die negative Bewertung bei der Wahl 2011 auf 62% zu 37% positive Bewertung ab und drehte sich zwischenzeitlich um. Nunmehr sehen 62% der befragten positiv in die wirtschaftliche Zukunft und 36% sehen diese pessimistisch.
Die persönliche wirtschaftliche Situation bewerteten 80% der Befragten als gut, nur 19% sahen diese als schlecht an. Gleichzeitig waren nur 41% der Befragten der Auffassung, dass sie von der künftigen Entwicklung Berlins profitieren würden, während mehr als die Hälfte (55%) dies verneinten.
Die bundesweit in dieser Form einmalige Konstellation im Parteiensystem mit zwei (ehemaligen) Volksparteien im Umfeld der 20-Prozent-Marke und gleich drei Verfolger-Parteien, die allesamt im mittleren Bereich zwischen 10 und 20 Prozent liegen, ist neben historisch erklärbaren Besonderheiten vor allem auf dieses synchrone Versagen von SPD und Union in Regierungsverantwortung zurück zu führen.
Gleichwohl war der Berliner Wahlkampf, je näher der Wahltermin rückte, in wachsendem Maß auch eine von bundespolitischen Themen und Polarisierungen geprägte Auseinandersetzung. Auch die Auswirkungen des Ergebnisses werden am Ende landes- und bundespolitischer Natur sein. Im Wahlkampf der Parteien und ihren Ergebnissen auch bundesweite Entwicklungen, die auch Fingerzeige für das Wahljahr 2017 darstellen.
Die wahlentscheidenden Themen lauteten:
- soziale Gerechtigkeit (West: 50%, Ost: 53%)
- Wirtschaft und Arbeit (West: 31%, Ost: 29%)
- Schule und Bildung (West: 26%, Ost: 23%)
- Flüchtlinge (West: 24%, Ost: 25%)
- Mieten und Wohnungsbau (West: 18%, Ost: 17%).
Fragiler gewordene Mitte-Links-Mehrheit in der Hauptstadt Berlin
Das wichtigste Ergebnis dieser Wahlnacht ist, dass die Koalition aus SPD und CDU in Berlin abgewählt ist. Berlin erhält nach fünf Jahren „großer“ Koalition erneut eine Mitte-Links-Regierung.
Nach der kurzen Amtszeit der rot-grünen Minderheitsregierung 2001 nach dem Sturz Diepgens durch konstruktives Misstrauensvotum, die von der damaligen PDS mehrheitssichernd toleriert wurde und bis zur Bildung des ersten rot-roten Senats amtierte, wird die nächste Berliner Regierungskoalition aller Voraussicht nach das zweite Mal eine Zusammenarbeit der drei Parteien zur Folge haben.
Zusammen haben die drei Parteien bereits seit 1990 bei allen Berliner Wahlen eine politische Mehrheit die jedoch ungenutzt blieb. Bei den Abgeordnetenhauswahlen erhielten sie nun etwas über 50 Prozent der gültigen Zweitstimmen, und damit einen Stimmenanteil, der unter dem der Wahlen von 2001 (61,4), 2006 (57,3) und 2011 (57,6) liegt, aber immer noch deutlich über dem Quorum für die Bildung einer stabilen parlamentarischen Regierungsmehrheit.
Die Hauptstadt hat wie in der Vergangenheit Mitte-links gewählt – ohne jedoch damit ein rot-rot-grünes Projekt zu formulieren. Besser regiert zu werden als bisher – mehr wird nicht erwartet, egal wie groß die Ankündigungen im Wahlkampf ausfielen in Bezug auf die Zahl neu zu bauender Mietwohnungen, einzustellender Beschäftigter im öffentlichen Dienst u.a..
Vergleicht man die summierten Zweitstimmenanteile der drei Parteien diesseits der Union bei den jeweils letzten Wahlen im Bund und den Ländern, dann kristallisiert sich schnell heraus, dass Berlin im Trend der Metropolenräume im Norden der Bundesrepublik liegt.
Gleichwohl müssen sich die drei Parteien, die nun voraussichtlich einen neuen Senat bilden werden, auch dem Fakt stellen, dass das Mitte-Links-Lager bei den Abgeordnetenhauswahlen 2016 insgesamt deutlicher Stimmen gewinnen konnte als noch zur Jahrtausendwende.
Berlin ist die Mitte-Links-Hauptstadt, aber es gibt keinen Anlass dafür, zu glauben, SPD, LINKE und Grüne hätten in dieser Stadt zusammen quasi natürlich eine parlamentarische Mehrheit.
Berlin hat den sich in den vergangenen Wahlen seit der Bundestagswahl 2013 abzeichnenden Verschiebung der politischen Mehrheiten in Deutschland nach Mitte-Rechts trotz eines zweistelligen Ergebnisses für die AfD (der aber durch Verluste für die CDU und andere Rechtsparteien zum Teil kompensiert wird) nicht in vollem Umfang nachvollzogen. Man könnte von einer Resilienz der Metropolenräume gegenüber Mitte-Rechts sprechen.
Rot-Rot-Grün geht mit guten Ausgangsbedingungen an den Start. Viele werden in einer Stadt, die mehrheitlich progressiv denkt und fühlt, die „links tickt“, wie LINKE-Spitzenkandidat Klaus Lederer zuspitzte, aufgeschlossen auf einen Mitte-Links-Senat reagieren. Viele Medien werden eine schon jetzt durchscheinende Lesart übernehmen, dass Rot-Rot-Grün eben auch irgendwie zu dieser Stadt passt.
Zu erwarten ist, dass die wahrscheinlichen Koalitionspartner jede bundespolitische Implikation des Wahlergebnisses von sich weisen werden. Daran wird insbesondere die gerupfte SPD ein Interesse haben. Der Fokus wird auf der Bildung des Senats und der Koalitionsvereinbarung liegen, mit dem die Probleme der Stadt in den Blick genommen werden.
Dies ist sinnvoll, denn
- die Wahlkämpfe und Strategien der Parteien im Verhältnis zu ihren Ergebnissen,
- der mit dem Regierungswechsel absehbare Erwartungsdruck aus der Stadtgesellschaft,
- die bekannten Schwierigkeiten im Binnenverhältnis der Parteien sowie
- eine parlamentarische Opposition, die aus einer traumatisierten und traditionell rechtslastigen Hauptstadt-CDU, einer AfD mit immer deutlicher ausgeprägten Zügen einer rechtsradikalen Sammlungsbewegung und der in Berlin immer noch marginalen FDP besteht,
stellen Herausforderungen dar, die #R2G nur mit kluger und strategisch angelegter Politik, spürbarer Verbesserung der Regierungsarbeit und Tätigkeit der Stadtverwaltung sowie in der Binnen- und Außenkommunikation neutralisieren kann.
Dergestalt kann R2G in der Berlin bis zur Bundestagswahl dazu beitragen, positive Signale im Hinblick auf eine solche Konstellation zu setzen. Eine natürliche Hegemonie hat R2G jedoch. Es ist eine fragiler gewordene politische Mehrheit, die die drei Parteien auf sich vereinigen. Ob daraus Hegemonie im eigentlichen Sinne wird, kann sich nur in der Arbeit der künftigen Koalition erweisen, wenn sie tatsächlich zustande kommt, wofür viel spricht.
SPD: Erschöpfte Regierender Bürgermeisterpartei
Die seit 1990 dauerregierende Hauptstadt-SPD gehört zu den Verliererinnen dieser Wahl. Sie ist – nachdem sie unter Klaus Wowereit Werte zwischen 28 und 30 Prozentpunkte erreichte – wieder auf das Niveau Mitte bis Ende der 1990er Jahre zurückgefallen (1995: 23,6%; 1999: 22,4%). Diese Wahlen galten als Tiefpunkte im historischen Gedächtnis der Berliner SPD und Höhepunkte der CDU unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Erhard Diepgen (CDU).
In diesen Wahlkampf ging die SPD deshalb mit einer sowohl mutigen, weil offensiven als auch gewagten Strategie. Aus der zutreffenden Analyse, dass mit einer Thematisierung von landespolitischen Themen für sie kein Mehrwert zu ziehen war und der Erkenntnis der vergangenen Wahlen, dass der Persönlichkeitsfaktor des Amtsinhabers an Bedeutung für die stärkste Regierungspartei zunimmt, zog sie unter der Regie des renommierten Kampagnen-Managers Frank Stauss – der bereits für die SPD in Rheinland-Pfalz die Aufholjagd von Malu Dreyer konzipiert hatte – die Konsequenz, eine auf den Regierenden Bürgermeister Michael Müller zugeschnittene, Kampagne umzusetzen.
In wachsender Abgrenzung zum Koalitionspartner CDU, die zuletzt von Stauss gar als „Stahlhelm-CDU“ betitelt wurde, arbeitete die Kampagne am Bild von einer kulturell vielfältigen und gut gelaunten Metropole, die zuletzt immer stärker auf die Botschaft „Gegen rechts – SPD wählen“ setzte und mit einem erheblichen Werbedruck in die Stadt getragen wurde.
Man darf den Kampagnenansatz getrost als gescheitert bezeichnen, auch wenn die Frage nach einer gangbaren Alternative seitens der SPD und nicht die Autoren dieser Wahlanalyse beantwortet werden muss. Doch die inhärenten und im Erzählverlauf auftauchenden Widersprüche im Narrativ von einem bedrohten Hauptstadtparadies, das von der SPD mit einem gutmütig-gewöhnlichen Bürgermeister an der Spitze verteidigt wird, waren zu stark, um am Ende die Stadtgesellschaft in einem für die Partei des Amtsinhabers an der Regierungsspitze angemessenen Maß zu mobilisieren.
Handwerkliche Kommunikationsfehler sowie schlecht bearbeitete und kommunizierte Skandale insbesondere um den SPD-Bausenator Geisel und dessen Verwaltung (Mauscheleien mit Investoren, Abweisung von Bewerbern zu Mieterbeiräten und Instrumentalisierung städtischer Wohnungsgesellschaften zu Image-Zwecken) rundeten das Bild einer ambitioniert gedachten Kampagne ab, die in der Umsetzung an der Realität einer SPD scheiterte, von der viele meinen, dass sie seit Jahren als Partei des Regierenden Bürgermeisters erschöpft ist, wenig ambitioniert und zu der es dennoch keine Alternative gibt – da auch die Grünen als Regierende Bürgermeisterin-Partei nicht zur Verfügung standen. Zu wenig bekannt war die Spitzenkandidatin Ramona Pop, die anders als vormals Renate Künast, getragen auf der grünen Sympathiewelle des Jahres 2011, nicht in der Lage sein konnte, den ernsthaften Eindruck zu erwecken, sie könne die Nachfolgerin von Michael Müller sein.
Infratest dimap zeigt, dass zwar die Hälfte der Befragten Wähler/-innen der Auffassung waren, dass die SPD gute Ideen für die Zukunft Berlins habe – davon waren sogar 80% der SPD-Wähler/-innen überzeugt – aber knapp zwei Drittel aller Wähler/-innen (61%) und ein Drittel der SPD-Wähler/-innen waren der Überzeugung, dass man derzeit nicht wisse, wofür die Partei inhaltlich stehen würde. Mehr als ein Drittel der SPD-Wähler/-innen (37%) war der Meinung, dass die Partei es in der Regierung nicht geschafft habe, die wirklichen Probleme anzupacken.
Die Kompetenzwerte der SPD gestalten sich ambivalent. Im Feld Soziale Gerechtigkeit büßt sie nach Daten von Infratest dimap 8 Prozentpunkte gegenüber 2011 ein und kommt nur noch auf einen Wert von 31%, wobei sie damit auch gegenüber der Partei DIE LINKE noch führt. In der Familienpolitik sinkt sie um 4% auf 31% ab, steigt jedoch in der Wohnungsmarktpolitik um 1 Prozentpunkt auf 31%. DIE LINKE liegt hier bei 26% und hat um 5 Prozentpunkte zugelegt. In der Arbeitsmarktpolitik steigt die Kompetenzzuschreibung für die SPD um 3 Prozentpunkte auf nunmehr 35% im Vergleich zu 2011.
Gleichwohl bietet der kurzfristig nicht allzu erfolgreiche Kampagnenansatz in mittelfristiger Hinsicht Potenziale für eine Revitalisierung der Hauptstadt-SPD, weil die Bildung eines rot-rot-grünen Senats oberflächlich wie die folgerichtige Konsequenz aus der im Wahlkampf verfolgten Strategie wirkt.
Ob die SPD diese Potenziale nutzen kann, wird sehr davon abhängen, ob sie den Eintritt in einen neuen Senat nicht einfach als Wechsel der Koalitionspartner verwaltet, sondern als Einstieg in eine neue Politik und vor allem eine neue politische Kultur gestaltet – kurzum die Kraft besitzt, sich wie 2001 neu zu erfinden.
CDU - Anhaltender Sinkflug
Die Hauptstadt-CDU setzt bei den Abgeordnetenhauswahlen 2016 ihren Sinkflug fort, erreicht erstmals in ihrer Berliner Geschichte ein Ergebnis von weniger als 20 Prozentpunkten und damit einen neuen Tiefpunkt ihrer an Niederlagen seit der Abwahl Diepgens im Wege eines konstruktiven Misstrauensvotums von SPD, Grünen und PDS im Jahre 2001.
Die Gründe für das miserable Abschneiden der Hauptstadt-CDU sind ebenso landespolitisch hausgemacht wie bundespolitischer Natur.
Rechnerisch hatten SPD, Grüne und PDS/DIE LINKE spätestens seit der Abgeordnetenhauswahl 1995 eine komfortable Mehrheit. Dass die CDU in dieser Zeit nicht nur den Regierenden Bürgermeister stellte, sondern auch den Eindruck erwecken konnte, dass sie die authentische Repräsentantin der Hauptstadt sei, lag an der damals noch bestehenden Abgrenzung gegenüber der PDS, die eine Zusammenarbeit mit ihr und somit politische Mehrheiten jenseits der CDU undenkbar erscheinen und insbesondere die SPD in Abhängigkeit zur CDU geraten ließ.
Erst Klaus Wowereit hatte die Kraft, seine Partei aus der babylonischen Gefangenheit der CDU heraus in die politische Dominanz gegenüber der CDU, die – nachdem 1999 Diepgen ein historisches Ergebnis von mehr als 40% für die CDU erreichte – auf einmal abgewirtschaftet erschien. Von diesem Image hat sie sich seitdem nicht mehr erholt. In Verbindung mit dem schwachen Abschneiden des Spitzenkandidaten 2006, Friedbert Pflüger, wechselnden Fraktionsvorsitzenden und den notorisch starken Bezirksfürsten, mit denen sich jede Führungspersönlichkeit arrangieren muss, stolperte sie 2011 eher in die nunmehr abgewählte Koalition, als dass sie souverän eintrat. Dazu trug der nur elf Tage nach Ernennung bereits notwendig gewordene Rücktritt des Justiz- und Verbraucherschutz-Senators Braun (CDU) ein Übriges bei. Braun hatte als Notar dubiose Immobiliengeschäfte beurkundet und soll – Medienberichten zufolge – bereits vor Amtsübernahme gewusst haben, dass es Beschwerden gegen ihn gab. Sein Versuch, die Geschäfte des Justizsenators fortzuführen und die des Verbraucherschutzsenators – eine Aufgabe, die gerade erst in das Justizressort überführt worden war – ruhen zu lassen, hatte ihm nicht geholfen.
In der Erklärung des Wahlergebnisses werden sich Landesverband und Bundesebene gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Es spricht viel dafür, dass sowohl der CDU-Landesverband Berlin unter dem Bürgermeister und Landesvorsitzenden Henkel als auch die Bundespartei mit Kanzlerin und Parteivorsitzender Merkel verloren haben.
Die CDU verfolgte in Berlin sehr viel stärker als die SPD eine auf landespolitische buchstabierte und traditionelle Kompetenzschwerpunkte des bürgerlich-konservativen Lagers fokussierte Wahlkampagne. Der zentrale Begriff der Berliner CDU-Kampagne war – interessanterweise und mit Blick auf demoskopische Befunde auch naheliegend – die Sicherheit.
Seit den 1990er Jahren changiert die Berliner CDU zwischen einem Flügel, der ein modernes und liberales Großstadt-Image anstrebt und einige Zeit vom früheren Finanzsenator Peter Kurth sowie der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt, Monika Grütters aber auch dem glücklosen Sozialsenator Czaja repräsentiert wurde und der traditionell konservativen vorrangig West-Berliner CDU, die im aus dem Osten der Stadt stammenden und vor Maueröffnung in den Westen übergesiedelten Innensenator Frank Henkel authentisch vertreten ist.
Innensenator Henkel drückte der Kampagne einen auf Innere Sicherheit setzenden Stempel auf, womit zwar einerseits auf die durchaus vorhandenen Bedrohungsängste vor terroristischen Anschlägen innerhalb der Berliner Bevölkerung reagiert wurde, andererseits aber erneut der Anschluss an diejenigen liberalen Stadtbewohner versäumt wurde, die nun – in der Wahl zwischen CDU, AfD und FDP zu den Liberalen wechselten, die traditionell in Berlin dann starke Ergebnisse einfahren, wenn die CDU am Boden liegt.
Hinzu kam, dass es die CDU nicht vermochte, ein wirksames Gegenmittel zur Strategie ihres Koalitionspartners zu entwickeln, der praktisch alle manifesten Ausdrücke des kollektiven Senatsversagens der CDU und ihren maßgeblichen Akteuren anheftete.
Schwaches und unglücklich agierendes Führungspersonal taten ein Übriges zur unwiderlegbar historischen Mobilisierungsschwäche der CDU, die sie praktisch auf ihre Hochburgen zusammen schmelzen lässt.
Verstärkt wurde diese Mobilisierungsschwäche durch die zunehmend prekäre Lage der gesamten Union, die derzeit einem Leck geschlagenen Ballon ähnelt. Dass Angela Merkels Wahlkampfauftritte in Berlin ohne Proteste und sprachliche Pannen kaum Aufsehen erregt hätten, ist dafür ein deutlicher Indikator.
Die CDU ging zwar als Regierungspartei aber aus der Defensive in diesen Wahlkampf und verlor ihn, weil sie weder ein mobilisierendes Thema, Anschlussfähigkeit an die Stimmung in den Teilen der Stadt, die nicht Mitte-Links wählen und weder gegenüber der AfD noch gegenüber der FDP ein inhaltlich tragfähiges Alleinstellungsmerkmal aufbieten konnte. Dass sie zudem nicht über ein mobilisierendes Personalangebot verfügte, obwohl auch die anderen Parteien unbestreitbar Landesliga spielten – fiel dann nicht mehr ins Gewicht.
Die Erkenntnisse von Infratest dimap unterstreichen diese Analyse. Jeweils mehr als zwei Drittel der befragten Wähler/-innen insgesamt (69%) und der CDU-Wähler/-innen (66%) meinen, dass Angela Merkels Flüchtlingspolitik der CDU geschadet hätte. In die gleiche Richtung gehen dürfte die zu 67% von allen Wähler/-innen geteilte Auffassung, dass die CDU kein Gespür mehr hätte für die Sorgen der kleinen Leute bzw. viele Positionen aufgegeben hätte, für die sie früher gekämpft habe (58%).
Obwohl die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin auch bei den CDU-Wähler/-innen in großer Mehrheit als schädlich für die Partei angesehen wurde, waren gleichzeitig von den CDU-Wähler/-innen mehr als drei Viertel (76%) der Meinung, dass die Kanzlerin ein wichtiger Grund sei, für die CDU zu stimmen. Dies sind übrigens 27% mehr als derjenigen CDU-Wähler/-innen, die nicht einmal zur Hälfte (49%) der Auffassung waren, dass Frank Henkel der richtige Mann sei, um Berlin zu repräsentieren. Von allen Wähler/-innen meinten dies im Übrigen nur 16%.
In den Kompetenzwerten hat die CDU auf den Feldern Wirtschaft (32%; -2% zu 2011), Kriminalitätsbekämpfung (32%; -5%), Arbeitsmarktpolitik (23%; -4%) und Bildungspolitik (18%; -4%) jeweils an Kompetenzzuschreibung in den Augen der von Infratest dimap Befragten verloren.
Auf die Berliner CDU warten nun mindestens fünf Jahre Opposition. Sie geht in eine für sie bereits gewohnte und dennoch unnatürlich empfundene Rolle als Nichtregierungspartei. Für die Hauptstadt-CDU wird nun viel darauf ankommen, ob es ihr gelingt, sich von einer zunehmend rechtsradikalen AfD abzugrenzen und bürgerlich-konservative Politik neu zu definieren, bei einer FDP-Fraktion in der Opposition, die sich die liberalen Themen nicht wegnehmen lassen wollen wird.
Sozialsenator Czaja, der mit 47,2% souverän seinen Wahlkreis im bürgerlichen Siedlungsgebiet des Bezirks Marzahn-Hellersdorf verteidigte und ggf. das beste Wahlkreisergebnis in ganz Berlin erreichte, wird im Fall der Fälle für weitere Führungsaufgaben in der Berliner CDU zur Verfügung stehen. In Marzahn-Hellersdorf gelang Czajas langjährigem Parteifreund Christian Gräff, vormaliger Abgeordneter und die vergangenen fünf Jahre Stadtrat (Dezernent) in Marzahn-Hellersdorf erstmals ein zweites CDU-Mandat, denkbar knapp mit 0,1% Vorsprung der linken Abgeordneten abzunehmen. Nicht unwichtig für Czaja, der nun nachweisen kann, wie man im Osten auch als CDU gewinnt.
Wie schwierig die nächsten Monate für die Union sein werden, zeigt die Thüringer CDU seit ihrem Machtverlust vor zwei Jahren, obwohl sie aus einer deutlich komfortableren Situation heraus und ohne FDP-Konkurrenz agiert.
Anzunehmen ist, dass die CDU in den nächsten Wochen innerparteiliche Konflikte austragen wird, die sie lähmen werden – selbst wenn diese Konflikte im Windschatten der zu erwartenden rot-grün-roten Senatsbildung stattfinden.
GRÜNE - Großstadtpartei mit kurzer Berliner Regierungserfahrung
Die Berliner Grünen traten mit einer einzigen wahrnehmbaren akzentuierten Botschaft im Wahlkampf an. Sie wollten nach ihren zwei kurzen Regierungsepisoden vor 27 und 15 Jahren erstmals wieder in einem Berliner Senat mitregieren. Dieses Wahlziel ist nach Lage der Dinge erreicht worden. Obwohl die Grünen einen prozentualen Verlust vergegenwärtigen müssen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Linkspartei darüber führten, wer drittstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus und damit zweitstärkste Kraft in einer möglichen Koalition wird, können auch sie sich als Sieger des Wahlabends fühlen.
Die Grünen gehen mit einem komfortablen Ergebnis in die Option einer Regierungsbeteiligung. Der ganz auf den Charakter einer Catch-all-Party angelegte Wahlkampf versprach nicht viel, worauf die Partei später festgelegt werden könnte, vielmehr setzte die grüne Kampagne auf einen Mix aus Vagheit in den politischen Aussagen und Emotionalisierung in der Bildsprache. Ebenso wie die SPD versuchte die grüne Partei in der Schlussphase des Wahlkampfs mit einer Mobilisierung „gegen rechts“ zu punkten. Der Eindruck, dass die Berliner Grünen bei dieser Wahl vor allem nichts falsch machen wollten und (in bezirklich durchaus unterschiedlicher Ausprägung) vor allem auf ihr kulturelles Kapital setzen, wird dadurch verstärkt. dass sie bei dieser Wahl im Wesentlichen ihre zwischenzeitlich seit den 2000er Jahren errungenen innenstädtischen Hochburgen verteidigten.
Von allen Parteien, die theoretisch im künftigen Senat vertreten sein könnten, haben allein die Grünen den Vorteil, dass die negativen Seiten der Stadtentwicklung ihnen aufgrund mangelnder Gelegenheit, als Regierungspartei auf die Entwicklung der vergangenen Jahre Einfluss zu nehmen, nicht zur Last gelegt werden können. Dieses Image, Newcomer im Senat und gleichzeitig seit den frühen 1980er Jahren ununterbrochen im Abgeordnetenhaus von Berlin vertreten zu sein, ist sicherlich einzigartig und wird sich nicht wiederholen.
Mehr als zwei Drittel (70%) der befragten Wähler/-innen würden es begrüßen, wenn die Grünen im Senat vertreten wären. Mehr als die Häfte von ihnen (58%) glauben, dass die Grünen früher als andere wichtige Probleme erkannt haben – davon sind die Grünen Wähler/-innen zu 87% überzeugt. Drei Viertel der grünen Wähler/-innen meinen, dass ihre Partei besser als andere verstünde, was Menschen in der Großstadt wollen und 57% der Wähler/-innen insgesamt sind der Auffassung, die Grünen hätten gute Ideen für die Entwicklung Berlins.
Interessanterweise sind mehr als die Hälfte der Wähler/-innen insgesamt (55%) und 54% der grünen Wähler/-innen der Meinung, dass die Grüne Partei sich in Berlin stärker von der SPD abgrenzen solle. Eine durchaus riskante Erwartung, waren doch diese Abgrenzungsbemühungen in den Jahren 2001 und 2011 wesentliche Motoren für die gescheiterten Sondierungen zwischen der Ampel 2001 und rot-grün zehn Jahre später.
Dass die Grünen in Berlin als die Flüchtlings- und Integrationspartei gelten, zeigt sich zumindest darin, dass mehr als die Hälfte (52%) aller befragten Wähler/-innen und wiederum 87% der grünen Wähler/-innen glauben, dass die Grünen als einzige Partei (uneingeschränkt) positiv gegenüber Flüchtlingen eingestellt sei.
Anzunehmen, ist, dass die Partei im Senat für dieses Thema die Verantwortung übernehmen möchte. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass der Partei bei den Kompetenzzuschreibungen für Integrationspolitik nur 19% Kompetenz zugestehen und damit 3 Prozentpunkte weniger als im Vergleich zu 2011.
Auch in den anderen Kompetenzwerten hat die Partei laut Infratest dimap im Vergleich zu 2011 abgenommen und zwar in der Umweltpolitik (69%; -9%), bei Familienpolitik (18%; -5%) und der Bildungspolitik (14%; -3%).
Spannend wird für die Partei der Einstieg in einen rot-rot-grünen Senat vor allem deshalb, weil nicht genau erkennbar ist, was sie in genau dieser Konstellation durchsetzen wollen und können. Den Hauptstadt-Grünen fehlt ein Herzens-Projekt. Sie könnten mit derselben Programmatik, Kampagne und personellen Aufstellung auch in eine andere Regierungskonstellation gehen. Diese Tendenz zur Beliebigkeit macht die Grünen auf mittlere Sicht zum schwierigsten Partner in progressiven Regierungskonstellationen, ihre Auflösung könnte für die Grünen in einer unweigerlich kommenden Wiederwahl-Konstellation zu einer vitalen Frage werden, die über Erfolg und Misserfolg bei kommenden Wahlen entscheidet.
DIE LINKE – Berappelt und erneut auf Regierungskurs
DIE LINKE steht an diesem Wahlabend zum ersten Mal seit über einem Jahr auf der Gewinnerseite. Die letzten großen Wahlerfolge feierte sie in Hamburg und Bremen. Ein Indiz dafür, dass die Partei in den größeren Städten stärker als in den Flächenländern konsolidiert ist, wozu sich die Autoren dieser Wahlanalyse an anderer Stelle bereits äußerten.
DIE LINKE setzte neben ihren bundes- und landespolitischen Kernthemen vor allem darauf, die Defizite in der politischen Kultur der Hauptstadt und das gestörte Verhältnis zwischen Politik, Hauptstadteliten und Stadtgesellschaft zu thematisieren. Dreh- und Angelpunkt ihrer Kommunikation war – für Wahlkämpfe ungewöhnlich – eine Frage: Wem gehört die Stadt?
Diese Frage wurde im Verlauf der Kampagne in eine Wahlaufforderung für DIE LINKE und die Aufforderung, über die Wahlentscheidung hinaus selbst aktiv zu werden, überführt. Man darf diesen Kampagnenansatz getrost als ambitioniert und riskant, am Ende aber als berechtigt erfolgreich bezeichnen. Der Versuch, Beobachtungen aus den im linken Lager sehr erfolgreichen Kampagnen von Bernie Sanders und Jeremy Corbyn aus dem angelsächsischen Raum in eine kontinentaleuropäische Wahlkampagne zu übertragen, kann als geglückt gelten. Er korrespondierte mit der Positionierung des Spitzenkandidaten Klaus Lederer als Stimme einer progressiv konnotierten Empörung in der Stadtgesellschaft, die ebenfalls, jedenfalls mit Blick auf das öffentliche Urteil über den Auftritt des linken Spitzenkandidaten, funktionierte.
Diese Botschaften scheinen angekommen zu sein, wie die Infratest dimap-Zahlen nahelegen. Jeweils mehr als die Hälfte aller befragten Wähler/-innen waren der Überzeugung, dass DIE LINKE sich am stärksten um sozialen Ausgleich bemüht (58%) und sich um mehr Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt kümmert (54%). Von den Wähler/-innen der LINKEN waren davon sogar 97% und 90% überzeugt. Fast 60% der Berliner Wähler/-innen fänden es gut, wenn DIE LINKE am Senat beteiligt wäre, und mit 98% sagten dies fast alle Wähler/-innen der LINKEN selbst, von denen 88% überzeugt waren, dass die Partei gute Ideen für die Entwicklung Berlins hätte und drei Viertel, dass man genau wisse, wofür sie steht.
Entsprechend hat die Partei auch bei den Kompetenzwerten zugelegt. Im Feld soziale Gerechtigkeit halten 26% der Befragten DIE LINKE für die kompetenteste Partei (+9% zu 2011), bei der Schaffung von sozialem Wohnraum 26% (+5%) und in der Familienpolitik 17% (+5%).
Auf dieser Grundlage errang DIE LINKE ein Ergebnis, dass wieder deutlich über dem Niveau liegt, auf das sie nach der ersten Legislaturperiode in der Regierung abgerutscht war und wieder in jene Regionen vorstößt, die sie vor der ersten Regierungsbeteiligung erreichen konnte. Das ist nur fünf Jahre nach einer Niederlage, wie sie schwerer kaum vorstellbar war und in Folge derer sie als erschöpft, vom regieren ausgelaugt und erfolglos angesehen wurde, alles andere als selbstverständlich. Den Beweis, dass DIE LINKE verloren gegangenes Vertrauen zurück gewinnen kann, hat der Berliner Landesverband erbracht. Der Beweis, dass sie es rechtfertigen und die gewonnenen Wähler/innen halten kann, steht nun aus. Denn DIE LINKE hat nur fünf Jahre nach dem Ende der rot-roten Koalition das Mandat für einen erneuten Regierungseintritt erhalten.
Die Berliner LINKE hat damit als einzige Landespartei in diesem Jahr eine Landtagswahl gewonnen. Sie hat keinen berauschenden Sieg errungen, aber ein Ergebnis, das ausreichen sollte, um Stabilität und Zuversicht für das kommende Superwahljahr zu gewinnen. Sie hat sich, und das ist vor dem Hintergrund vieler Diskussionen über das Konkurrenzverhältnis zur AfD nicht zu vernachlässigen, im Osten wieder die Rolle als stärkste politische Kraft erkämpft. DIE LINKE kann im Osten gewinnen, DIE LINKE kann in Metropolen gewinnen, DIE LINKE kann Wahlkämpfe gewinnen, in denen sie sowohl Protest als auch einen Gestaltungsanspruch artikuliert. Diesen Beweis hat die Berlinwahl erbracht. Nicht erspart wird der LINKEN durch diese Wahl die beginnende Diskussion um eine erfolgversprechende Strategie für die Bundestagswahl und die davor liegenden drei Landtagswahlen in westdeutschen Flächenländern, in denen mit Blick auf frühere Wahlen, aktuelle Umfragen und das von Berlin voraussichtlich ausgehende Signal die Frage nach der Bildung von rot-rot-grünen Landesregierungen wieder aktuell werden wird. DIE LINKE steht bundesweit vor einem strategischen Klärungsprozess, für den der Ausgang der Berlin-Wahl wichtige Hinweise gibt.
Die Berliner LINKE steht vor drei Herausforderungen:
1. Sie muss als Landespolizei die im Wahlkampf errungene Geschlossenheit im Prozess der Regierungsbildung halten.
2. sie muss damit umgehen, dass an sie von den drei Regierungsparteien wahrscheinlich die höchsten Erwartungen gestellt werden. Mehr als für die beiden anderen Parteien gilt für die Berliner LINKE, dass nach der Wahl vor der Wieder-Wahl ist. Dies erfordert einen strategischen Ansatz, der die existierenden Überlegungen für eine neue Kultur in einem Drei-Parteien-Bündnis und die Kernprojekte einer linken Regierungsarbeit (z.B. Schulbauoffensive in öffentlich-öffentlichen Partnerschaften) konsequent umsetzt.
3. Die Partei ist damit konfrontiert, dass sie beträchtliche Erfolge in alten und neuen Hochburgen feiern kann. Hierzu gehören für die alten Hochburgen Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick, sowie prototypisch für neue Hochburgen der Wahlkreis Mitte 4 (nördliches Moabit, Westhafen), der klassisch West-Berliner Territorium umfasst und in dem mit Steve Rauhut ein im Kiez fest verankerter Pfarrer gehörte. Er errang mit rund 19% ein hervorragendes Ergebnis. Gleichwohl sind die langfristigen strukturellen Trends in Ostdeutschland der Partei mit der absolut kleiner werdende Gruppe der vormaligen DDR-Stammwähler/-innenschaft weiterhin wirksam. Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die aktuellen Wahlergebnisse der LINKEN im Osten der Republik, von Sachsen und Brandenburg 2014 (mit einem durch spezifische Faktoren erklärbaren Ausreißer nach oben: Thüringen) bis zu Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 2016 und nunmehr auch mit den Verlusten in Lichtenberg, in Pankow, in Marzahn-Hellersdorf und auch in Treptow-Köpenick auf bekannte demographische Entwicklungen zurück zu führen sind: die PDS wächst langsam aus der Alterspyramide der Wahlberechtigten heraus und DIE LINKE wächst von unten nur langsam – in einzelnen Regionen zu langsam – nach.
Piratenpartei - from dawn till dusk
Die Berliner Piraten waren die Shootingstars der vergangenen Abgeordnetenhauswahl. Erstmals zogen sie im September 2011 in deutlicher Fraktionsstärke in einen Landtag ein. Es war ein spektakulärer Erfolg, dem weitere Mandate im Landtag NRW und Schleswig-Holstein folgen sollten.
Die damalige Abgeordnetenhausfraktion wurde mit einem erheblichen medialen Interesse bedacht, das im Zusammenhang mit dem Gewinner-Image in die Wahlerfolge des Jahres 2012 mündete. Die Piraten, so lautete der durch vorliegende Daten und stattfindende Wahlen erhärtete Befund im Wahlnachtbericht 2011, waren eine Partei der Unter-45-jährigen, die politische vor allem die Themen und Probleme einer Generation von zunehmend prekär arbeitenden und lebenden Menschen auf die Tagesordnung setzte.
Nach fünf Jahren muss man feststellen, dass es den Piraten nicht gelungen ist, aus diesem disparaten Mix von Wünschen und Lebenslagen ein kohärentes Politikkonzept und eine über einmalige Proteststimmen hinausreichende Mobilisierungsperspektive zu entwickeln.
Aus Transparenz wurde Streit und Spaltung. Aus Vielfalt wurde Beliebigkeit und Inhaltsleere. Dieser Befund ist kein Grund zur Schadenfreude, weil es die Frage hinterlässt, wo viele dieser Menschen, die mehrheitlich im Mitte-Links-Lager verortet sind, als Wähler/-innen verbleiben. Der Wähler/-innenwanderungsübersicht von Infratest dimap zufolge wandern 19.000 frühere Wähler/-innen der Piraten in das Nichtwähler-Lager. Von dort hatte die Partei 2011 und 21.000 Wähler/-innen mobilisiert. Zu den anderen Parteien wandern 10.000 Wähler/-innen (2011: +21.000), zur AfD 11.000, zu den Grünen 12.000 (2011: +16.000) und zur SPD, der CDU und der FDP insgesamt 11.000 (2011: +23.000). Von der LINKEN erhielten die Piraten bei der vergangenen Berlin-Wahl 12.000 Wähler/-innen, nunmehr wandern 23.000 frühere Wähler/-innen dorthin ab.
Ursache dafür könnte sein, dass es die Berliner LINKE vermochte, einem Teil der früheren Piraten-Protagonist/-innen eine politische Heimat anzubieten. Ob sich daraus ein Teil der Zuwächse für DIE LINKE erklären lässt, kann erst mit später vorliegenden Daten beantwortet werden. Es bleibt zu hoffen, dass damit wenigstens ein Teil des kreativen und originellen Politikansatzes der Piraten gerettet wird und in Spurenelementen sogar in der Politik eines rot-rot-grünen Senats wiederzufinden sein wird.
Im zehnten Jahr ihrer Existenz ist die Piratenpartei auf dem Niveau der Liberalen Demokraten (LD), einer sozialliberalen Abspaltung der FDP in den frühen 1980er Jahren, angekommen. Die DL haben auf ihre Art und ohne jemals dem temporären Erfolg der Piratenpartei auch nur in Ansätzen nahe gekommen zu sein, dennoch zur politischen Entwicklung der Bundesrepublik beigetragen. Dies bleibt auch den Piraten zu wünschen, denn die im Wahlnachtbericht von Horst Kahrs und Benjamin-Immanuel Hoff nach der NRW-Wahl 2012 zu den Piraten getroffene Aussage ist weiterhin zutreffend:
„Die Piraten-Partei bleibt ein schillerndes neues Phänomen in der deutschen Parteienlandschaft und ist daher als Projektionsfläche für vielerlei Motive geeignet ist. Ihre Wahlerfolge zeug[t]en von einer verbreiteten Unzufriedenheit mit dem real existierenden politischen Betrieb und seinen parlamentarischen Parteien.
Der Erfolg der Piraten legt eine weit verbreitete Überdrüssigkeit mit dem vorhandenen Parteiangebot offen, eine weit verbreitete Bindungs- und Orientierungslosigkeit im vorhandenen Angebot und ein entsprechendes Bedürfnis nach einer Alternative, eine Alternative, die die nicht als fertiges Angebot präsentiert wird, die nicht die politische Richtung um 180 Grad dreht, sondern die unfertig ist, offen und aus verschiedenen Elementen zusammengefügt, eine Alternative zu den professionellen politischen Eliten.
Das Bedürfnis nach einer Veränderung scheint in der Gesellschaft, zumal bei den unter 40-jährigen, weit verbreitet und geprägt von ideologischer Richtungslosigkeit im klassischen Sinn. Drückte sich zuvor die Auffassung, dass es so wie es ist nicht weitergehen kann, in der Wahl von Parteien auf den Polen ‚Markt/Individuum‘ (FDP) oder ‚Staat/Gesellschaft‘ (DIE LINKE) aus, so steht die Wahlentscheidung für die Piraten gegen die Abschottung des politischen Systems vom Alltag, gegen das ‚Politsprech‘, für die Freiheit des Individuums und für gesellschaftliche, gemeinschaftliche Einrichtungen.“
Dass der ehemalige Piraten-Parteivorsitzende Bernd Schlömer nunmehr für die wieder auferstandene FDP in das Berliner Abgeordnetenhaus einzieht, ist eine Ironie der Geschichte und dürfte dennoch dazu beitragen, Spurenelemente der Piratenpartei auch im künftigen Parlament zu erhalten.
AfD - Konkurrenz für die Union und elektoraler Klotz am Bein der Linken
Die Berliner AfD hat einen Wahlkampf geführt, der ganz in der Tradition früherer rechtsradikaler und rechtspopulistischer Protestpartei (z.B. Republikaner) voll und ganz auf den Affekt gegen „die da oben“ setzte und inhaltlich beinahe ausschließlich die Themen Flüchtlings- und Sicherheitspolitik kommunizierte. Berlinspezifisch war der deutlich wahrnehmbare taktische Versuch, in der politischen Kommunikation etwas moderater als die Bundespartei und ihr rechtsradikales dynamisches Zentrum um Björn Höcke und die ostdeutschen Landeschefs aufzutreten.
Das ständige Gejammer über tatsächliche oder vermeintliche Angriffe auf AfD-Wahlkämpfer/innen gehört dagegen zum bundesweiten Standardrepertoir rechtspopulistischer Propaganda. Die Kampagne der AfD war abgesehen von einem etwas holprigen Artwork derart professionell und flächendeckend umgesetzt, dass sie kaum von einer Parteiorganisation im Aufbau aus sich heraus getragen worden sein kann.
In der Wahlnachtberichterstattung zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern führte Horst Kahrs aus, dass nicht noch nicht belegen ließe, ob die AfD tatsächlich politikferne und notorische Nichtwähler/-innen mobilisieren würde. Wohl aber, dass die bundespolitische interessierte Bürgerinnen und Bürger, die die letzte Landtagswahl mieden, mobilisiert. Da die anderen Parteien das bundespolitische Spielfeld mieden, und auf Landesthemen orientierten – was ihnen sieht man die Grünen und die LINKE eher zum Vorteil gereichte – entstand eine Schieflage zu Gunsten der AfD in einem Teil des Elektorats, von dem jedoch angenommen werden kann, dass die anderen Parteien dessen Stimmen nicht bekommen hätten.
Nach Angaben von Infratest dimap gingen 75% aller befragten Wähler/-innen davon aus, dass die AfD vor allem gewählt wird, um ein klares Zeichen gegen die anderen Parteien zu setzen. Davon waren auch 91% der AfD-Wähler/-innen überzeugt. Dass die AfD verstanden habe, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen, meinten 42% aller Befragten und 97% der AfD-Wähler/-innen. Von denen begrüßten 99%, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen begrenzen will und zu 95%, dass sie die Ausbreitung des Islam in Deutschland verhindern wolle. Beide Ziele wurden zu weniger als einem Drittel (30%) von allen befragten Wähler/-innen unterstützt.
Während 84% aller Wähler/-innen kritisierten, dass die AfD sich nicht genug von rechtsextremen Positionen distanziere, hielten dies nur 51% der AfD-Wähler/-innen für ein Problem.
Die Berliner AfD gehört zwar zu den Gewinnerinnen dieser Wahl, blieb jedoch deutlich unter ihren zuletzt errungenen Ergebnissen in den ostdeutschen Flächenländern. Gleichwohl hat sie auch in Berlin die Größenordnung einer Mittelpartei auf Tuchfühlung mit LINKEN und Grünen, die ihrerseits auf die deutlich geschrumpften CDU und SPD herangerückt sind.
Sie stellt künftig Direktmandate im Berliner Abgeordnetenhaus und zwar in den Ostberliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Pankow und Treptow-Köpenick. In Marzahn-Hellersdorf wurde die AfD zudem mit 23,6 Prozent der Zweitstimmen stärkste Partei.
Nach dpa-Angaben ging das erste Mandat an Kay Nerstheimer im Wahlkreis Lichtenberg 1. Er kam nach Angaben der Landeswahlleiterin bei den Erststimmen auf 26,0 Prozent und erhielt damit einen Prozentpunkt mehr als die Linke-Kandidatin Ines Schmidt. Laut Antifaschistischem Pressearchiv und Bildungszentrum (apabiz) trat er 2012 im Internet als Berliner Chef der islamfeindlichen rechtsextremen Vereinigung «German Defence League» auf. Nerstheimer habe demnach angekündigt, diese zu einer «Miliz» auszubauen. Weitere Direktmandate gingen in den Wahlkreisen Marzahn-Hellersdorf 1 und 3 an die Kandidaten Gunnar Lindemann und Jessica Bießmann - sie holten 30,6 beziehungsweise 29,8 Prozent der Erststimmen. Ebenfalls direkt gewählt wurde Frank Scholtysek (AfD) - er erhielt 23,8 Prozent im Wahlkreis Treptow-Köpenick 3. Im Wahlkreis Pankow 1 - dazu zählt etwa der Stadtteil Buch am nördlichen Berliner Stadtrand - war AfD-Kandidat Christian Buchholz mit 22,4 Prozent der Erststimmen erfolgreich.
In diesen Bezirken könnte sie aufgrund des Proporz-Systems bei den Bezirksämtern Anspruch auf die Besetzung von Stadtratsposten erheben, die der Funktion von Dezernenten in anderen Städten entsprechen. Damit würde die AfD erstmals in Gemeinweisen, die jeweils für sich genommen der Größenordnung von Großstädten entsprechen, Gestaltungsverantwortung erhalten. Für die Konsolidierung der Partei rechts von der Union, dürfte dies ein Meilenstein sein.
Gefragt, woraus die Wahlentscheidung erfolgte, antworteten 26% der von Infratest dimap befragten AfD-Wähler/-innen, dass sie die Partei aus Überzeugung wählten, während 69% angaben, die Partei aus Enttäuschung über andere Parteien gewählt zu haben.
Fast die Hälfte ihrer Wähler/-innen mobilisiert sie aus dem Lager der Nichtwähler/- innen, den zweiten großen Block holt sie – wie in den anderen Wahlen – aus der Gruppe der anderen Parteien, worunter diejenigen Kleinparteien zu verstehen sind, die nicht im Parlament vertreten sind. Bezogen auf die Größenordnung der Stimmenanteile gewinnt sie alsdann von der CDU, der SPD, von Piraten und Linkspartei, in kleinem Maße von Grünen und FDP.
Nur jeder 14. Wähler/-in kommt von der LINKEN. Im Osten liegt die AfD klar hinter der LINKEN, auch im Westen kann sie sich nicht von der LINKEN absetzen. Insofern dürfte das Berliner Wahlergebnis zumindest zu einer Versachlichung der Debatte über das Verhältnis zwischen AfD und LINKEN beitragen.
Im direkten Konkurrenzverhältnis bleibt die AfD vor allem ein Problem der Unionsparteien. Als politische Kraft, die ein bislang weitgehend ungebundenes Wähler/-innenpotential destruktiv mobilisiert, bleibt sie ein Problem aller demokratischen Parteien, auch und nicht zuletzt der LINKEN.
Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen in der Wahlnacht legen nahe, dass die Wähler/-innen der AfD zu 45% von Sonstigen Parteien und den Nichtwähler/-innen kamen, zu 22% von der CDU, zu 12% von der SPD, zu 10% von der Piratenpartei, erst dann zu 7% von der Linkspartei und zu jeweils 2% von den Grünen und der FDP.
DIE LINKE erhält durch das Berliner Wahlergebnis einen Anlass und eine Chance, ihre strategische Debatte über die Rolle und Aufstellung der Partei in einem Sechs-Parteien-System mit der AfD auf rationalere Füße zu stellen.
Wir vertreten die These, dass DIE LINKE die AfD richtig nicht als eine direkte Konkurrentin um linke Wählerinnen und Wähler behandelt sondern als Herausforderung, den eigenen Entwicklungsprozess von einer linken Protestpartei gegen die Agenda 2010 zu einer Partei, die ihren Teil dazu leistet, neue linke Mehrheiten herauszubilden und gestaltungsfähig zu machen.
Die AfD ist aktuell ein elektoraler Klotz am Bein der LINKEN, weil sie das politische Feld nach rechts vergrößert und damit den relativen Anteil des aktuellen linken Wähler/-innen-potenzials verkleinert. Es liegt nun an der LINKEN, ihrerseits das Feld zu erweitern und die Repräsentationslücke in der linken Mitte zu schließen. Die Wiederaufführung einer auf die AfD fixierten Strategiediskussion wäre ein gewaltiger Fehler.
Fünf Politiker der AfD sind bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl direkt gewählt worden. Die von der AfD im Ostteil der Stadt gewonnenen Direktmandate sind ein deutliches Warnzeichen in einer Wahlnacht, in der DIE LINKE sich über gewonnene Direktmandate in den Ost-Bezirken freuen kann.
FDP – notorisches Stehaufmännchen in Zeiten schwächelnder CDU
Die Berliner FDP ist kein kontinuierlicher Bestandteil des parlamentarischen Systems der Stadt. Bei den Wahlen 1958 (3,8%), 1989 (3,9), 1995 (2,5), 1999 (2,2), 2011 (1,8) schied sie jeweils aus dem Berliner Abgeordnetenhaus aus.
Die Partei setzte im Wahlkampf ausschließlich auf zwei Themen: Wirtschaft und die Offenhaltung des Flughafen Tegels. Nicht ohne Erfolg, wie Infratest dimap-Daten zeigen.
Die Partei, die vom Bruder des bisherigen Sozialsenators angeführt wird, konnte mit der Tegel-Botschaft insoweit durchdringen, dass 99% der FDP-Wähler/-innen diese Zielsetzung mit der FDP verbanden und immerhin 61% aller befragten Wähler/-innen. Dass die FDP sich um Belange der Wirtschaft kümmere, begrüßten 53% aller Wähler/-innen.
Die FDP als gute Alternative für alle, die sich bei der CDU nicht mehr aufgehoben fühlen, sagen 94% der FDP-Wähler/-innen. Der Wählerwanderungstabelle von Infratest dimap ist zu entnehmen, dass der größte Block der FDP-Wähler/-innen tatsächlich von der Union stammte, gefolgt von Zuströmen der Nichtwähler/-innen – mit einem 50% kleineren Umfang. Weitere Stimmen kamen in der Reihung der Größenordnung von SPD, Grünen und Piraten.
Mehrheitliche Präferenz für Rot-Rot-Grün aber Skepsis gegenüber SPD
Wir haben in den vergangenen Wahlnachtberichten darauf hingewiesen, dass sich anhand des Indikators „Zustimmung zur Regierung“ der jeweiligen Gebietskörperschaft bereits ermessen lässt, ob eine potenzielle Wechselstimmung vorliegt oder nicht. Inwieweit eine Wechselstimmung tatsächlich wirksam werden kann, hängt ihrerseits erheblich vom Grad der Wahlbeteiligung ab, also davon, wie viele der Wahlberechtigten ihrem Wechselwunsch durch Stimmabgabe Ausdruck verleihen. Zudem differenzieren wir hinsichtlich des Wechsels einer Regierung zwischen drei Varianten:
- Einem großen Regierungswechsel: Dies ist entweder der komplette Austausch der die Regierung stellenden Parteien oder ein signifikanter Wechsel der politischen Regierungsprogrammatik. In letztere Kategorie fällt der Wechsel der FDP 1982 von der sozialliberalen Koalition unter Schmidt zur schwarz-gelben Koalition unter Kohl oder der Wechsel der Berliner SPD vom Bündnis mit der CDU zum rot-roten Senat 2002, wenn mit dem Wechsel des Partners auch eine wesentliche Programmatik entfällt.
- Dem kleinen Regierungswechsel, also dem Austausch eines der Regierungsparteien, wobei dies in der Regel den Verbleib der größeren Regierungspartei bedeutet, während der kleinere Partner ausgetauscht wird. Ein „kleiner Wechsel“ liegt jedoch auch dann vor, wenn die größere Regierungspartei des bisherigen kleineren Partners verlustig geht und allein weiter regieren kann. Das bestimmende Merkmal ist die Aufrechterhaltung der wesentlichen politischen Programmatik der betreffenden Regierung.
- Kein Regierungswechsel liegt vor, wenn kein Austausch der die Regierung stellenden Parteien vorgenommen wird.
Die Wahl vom 18.09.2016 dürfte erneut einen Großen Regierungswechsel darstellen, da eine Koalition aus SPD, DIE LINKE und Grünen die höchste Wahrscheinlichkeit hat.
Eine solche Koalition präferierten nach Angaben von Infratest dimap 49% der Befragten. Ein Bündnis aus SPD, CDU und FDP wurde von 28% bevorzugt. Auf den dritten und vierten Rängen folgen eine Ampel-Koalition (25%) und ein Jamaika-Bündnis (20%).
Von den Parteianhänger/-innen der drei Mitte-Links-Parteien sprachen sich 90% der LINKE-Wähler/-innen, 82% der Grüne-Wähler/-innen und 70% derjenigen, die der SPD ihre Stimme gegeben hatten für ein rot-rot-grünes Bündnis aus.
Für eine Ampel konnten sich 47% der Grüne-Wähler/-innen erwärmen, 37% derjenigen, die SPD gewählt hatten und 38% der FDP-Wähler/-innen.
Letztere präferierten wiederum zu 68% ein Bündnis aus SPD, CDU und FDP, das auch 71% der CDU-Wähler/-innen bevorzugten, jedoch nur 23 der SPD-Wähler/-innen.
Ein Jamaika-Bündnis fand die Zustimmung von 58% der FDP-Wähler/-innen, 52% der CDU- aber nur 15% der Grünen-Wähler/-innen.
Bemerkenswert ist die seitens Infratest dimap vor der Wahl erfragte Präferenz für diejenige Partei, die den nächsten Senat anführen sollte. Zwar sprachen sich 91% der SPD-Anhänger/-innen und 41% aller befragten Wahlberechtigten für eine Führungsrolle der SPD aus, doch hatte die Zustimmung bei allen Wahlberechtigten im Vergleich zu 2011 um 13 Prozentpunkte abgenommen. Während in Mecklenburg-Vorpommern die Anhänger/-innen der Grünen zu 82% und der Linkspartei zu 72% eine SPD-geführte Landesregierung begrüßten, liegt die Zustimmungsrate zur Führung der SPD im nächsten Senat bei 43% Grüne-Anhänger/-innen und 41% Anhänger/-innen der LINKEN.