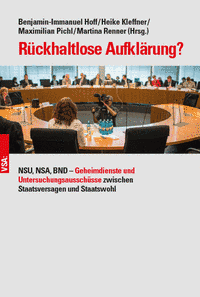Die Crux mit der politischen Führung
Am Sonntag bekommt die Sozialdemokratie mal wieder einen neuen Chef. Der Parteienforscher Prof. Dr. Franz Walter (Uni Göttingen) blickt in der Frankfurter Rundschau zurück auf die Führungsqualitäten früherer Vorsitzender und zeigt
Von "politischer Führung" wird in Expertenkreisen der Politik gern geredet. Doch ist der Begriff durchaus vieldeutig, offen, interpretationsfähig. Vielleicht ist er gerade unter Journalisten eben deshalb so beliebt. Er bietet die probate Gelegenheit, Politik zu personalisieren. Parteikrisen werden so kurzerhand zu Führungskrisen transferiert. Dann geht es in den Kommentaren nur noch um Führungsschwächen des einen, Führungsstärken des anderen Kandidaten, um Persönlichkeitsbilder und Charakterfragen, was das Publikum besser unterhält als die trockene politologische Analyse parteiorganisatorischer Defizite.
Politikwissenschaftler haben eben deshalb sehr viel größere Probleme damit, den Begriff Führung zu verwenden. Politologen in Deutschland tun sich besonders schwer damit. Sie definieren ihn nicht in ihren Lexika, erläutern ihn nicht in ihren Handbüchern, verfassen erst recht keine Bücher darüber. Führung kommt in einem Großteil der deutschen Politikwissenschaft nicht vor. Das wird gewiss mit der Stigmatisierung dieses Begriffs durch die Nationalsozialisten zusammenhängen, ist aber mindestens ebenfalls darin begründet, daß die Politologen hier zu Lande besonders seit den späten sechziger Jahren auf gesellschaftliche Prozesse fixiert sind, auf Systemzusammenhänge, auf Strukturen. Sie sind damit allerdings nicht weniger einseitig als die von ihnen oft verachteten Journalisten. Die einen übertreiben die Bedeutung des politischen Führungspersonals, die anderen ignorieren sie häufig genug.
Allerdings ignorieren auch Politikwissenschaftler nicht mehr, dass durch die Personalisierung der Medien Politik tatsächlich stärker personalisiert worden ist. Personalisierung gehört somit zu den realen Prozessen in der Politik, zu den Strukturen, die Parteien prägen und verändern. Eine Zeit lang wurde unter Sozialwissenschaftlern sogar besonders gerne von einer "Bonapartisierung" der Politik gesprochen. Man prognostizierte einen zunehmenden Bedeutungsverlust der traditionellen Parteistrukturen zu Gunsten der über die Medien direkt mit den Wählern kommunizierenden Parteiführer. Dergleichen las man besonders in den tollen Jahre der Westerwelles, Möllemanns, Haiders, Schröders, als solche Diagnosen wohlfeil durch die Landschaft mäanderten.
Doch wurden diese Positionen im Grunde eher en passant formuliert, oft auch in unverkennbar provokativer Absicht. Zu einer wirklichen und fundierten Debatte über Führung in der Politik haben sich derlei Einwürfe nie verdichtet. Insgesamt blieb es dabei: Die Macher in Medien und Politik setzen immer mehr auf Personalisierung; die Politologen gucken währenddessen mehrheitlich weg.
Insofern sind alle Fragen offen. Denn was heißt "Führung" eigentlich genau, vor allem: was ist gelungene Führung? Eben das fragt sich das ganz kommentierende Deutschland immer wieder dann, wenn die Sozialdemokraten abermals ihren Vorsitzenden wechseln. Am Sonntag ist es erneut so weit. Kurt Beck steht vor der Pforte. Und wieder stecken die Politprofis die Köpfe zusammen, um über Führungsprobleme und Führungsmöglichkeiten in der SPD zu raunen. Versuchen wir also, aus den Erfahrungen sozialdemokratischer Parteivorsitzender nach 1945 eine kleine Bilanz zu ziehen.
Von einer medial betriebenen Bonapartisierung der sozialdemokratischen Parteiführung im Zuge der Mediengesellschaft wird man ernsthaft nicht mehr reden können. Den Medien-Bonaparte Schröder hielt es auch nur wenige, unerquickliche Jahre im Amt, bis er durch den Eigensinn der überlieferten Parteimentalität abgestoßen, sodann vom Repräsentanten der Organisation, des Apparats, "der Sache", eben Franz Müntefering, abgelöst wurde, was zeitgleich im Übrigen auch in anderen Parteien so ähnlich ablief, da überall die früheren Generalsekretäre zu Parteichefs avancierten. Doch auch Müntefering konnte nicht der rundum souverän entscheidende Parteiautokrat werden, zu dem ihm viele Interpreten bereits stilisiert hatten. Und mit Kurt Beck wird nun ein Mann an der Spitze stehen, dem jedes bonapartistisches Charisma abgeht.
Im Grunde trug die bundesdeutsche SPD lediglich ein einziges Mal bonapartistische Züge: 1945 bis 1952 mit Kurt Schumacher. Doch damals war der Einfluss der Medien denkbar gering; die Partei war sozial, kulturell, politisch ganz und gar traditional. Bezeichnend jedenfalls war, dass sich dann mit dem Wandel der SPD von der homogenen Klassenpartei zur heterogenen Volkspartei auch die Führungsstruktur ausdifferenzierte und pluralisierte. Die kollektive Führung trat an die Stelle der monokratischen Parteileitung. Die SPD erlebte die Zeit der Troika, also des Führungsgespanns aus Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt.
Damals, in den 1960 bis 1990er Jahren, war die kooperative Führung ein adäquates Führungsmodell für die moderne SPD. Ein einzelner Parteiführer allein konnte das weite Panorama unterschiedlicher politischer und kultureller Orientierungen verschiedenster Generation nicht mehr abdecken. Dem legendären Triumvirat mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen, Temperamenten und Profilen aber gelang dies über lange Zeit mit beträchtlichem Erfolg, auch wenn sich die drei untereinander alles andere als grün waren. Insofern war die kollektive Führung sicher ein modernes Organisationsprinzip für komplex zusammengesetzte Institutionen in zunehmend zerfasernden Gesellschaften. Aber die Führungskrisen in der SPD von Brandt bis Lafontaine demonstrierten auch, daß die kollektive Führung immer wieder Stoff für Interessenkonflikte und Rivalitäten produzierte. Die kollektive Parteileitung war insofern keineswegs ein Patentrezept; sie war ein höchst ambivalentes Führungsinstrument.
Doch seit einigen Jahren sind die Sozialdemokraten im Grunde nicht mehr ganz so kompliziert zu dirigieren wie noch in den 1970er bis 1990er Jahren. Denn der weitgefächerte, kulturelle, experimentierfreudige Lebensstilpluralismus der linken Mitte in der deutschen Gesellschaft ist zuletzt erheblich zurückgegangen. In der Ära Brandt hatte sich die Anhängerschaft der SPD noch in äußerst heterogene Wertegruppen auf- und ausgefächert; das Spektrum reichte von ökopazifistischen und kosmopolitischen Studienräten bis zu mehr konsumistischen und eher ausländerfeindlichen Unterschichtangehörigen. Keine andere bundesdeutsche Partei hatte in jenen Jahren eine in sich so widersprüchliche Wählerschaft wie die Sozialdemokraten; nirgendwo sonst waren die politischen Optionen, Lebenslagen und Einstellungen so vielfältig, ja: gegenläufig wie hier. Daher mussten sozialdemokratische Vorsitzende Virtuosen des Sowohl-als-auch sein, was indes stets zu Lasten politischer Kohärenz ging und folgerichtig konstant Unmut auch bei den eigenen Leuten hervorrief.
Doch damit ist es weitgehend vorbei. So groß ist der Spagat nicht mehr, den die Sozialdemokraten zum Zwecke der Wähler- und Mitgliederintegration realisieren müssen. Die postmaterialistische Flanke hat wesentlich an Bedeutung eingebüßt, auch an Konsistenz und Zielstrebigkeit. Denn die postmaterialistischen Generation der 1980er Jahre hat- nunmehr älter geworden sowie beruflich und privat stärker belastet - mittlerweile ebenfalls die Bedeutung materielle Sekurität entdeckt. Und infolgedessen wirkt die einst so unruhige SPD längst nicht mehr so rauflustig, von elementaren kulturellen Spannungen durchzogen wie in früheren Jahrzehnten. Einen starken oppositionellen Flügel gibt es faktisch nicht mehr in der Partei; dazu fehlt der rhetorisch mitreißende Tribun, dazu mangelt es vor allen an einem glanzvollen Gegenkonzept, an der zündenden Alternative zur sozialkapitalistischen Resignationspolitik. Und dennoch entbindet das auch den nächsten Parteivorsitzenden nicht vom komplizierten Management der Heterogenitäten. Schließlich haben die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl 2005 über eine halbe Million früherer Wähler an die Christliche Union verloren, gut eine Million aber zugleich an die Linkspartei. Daher wird also auch der neue Parteivorsitzende sich in der Disziplin des Spagats üben müssen, solange er jedenfalls prinzipiell am volksparteilichen Anspruch festhalten will.
Man darf also gespannt sein, wann die Ersten in der SPD auch über den neuen Parteivorsitzenden zu grummeln beginnen.
Der Autor
Franz Walter ist Professor für Politikwissenschaft und Leiter der "Arbeitsgruppe Parteienforschung" an der Universität Göttingen. Er schrieb mehre Bücher, zuletzt "Die ziellose Republik. Gezeitenwechsel in Geschichte und Gesellschaft"(Köln 2006).
Der dokumentierte Text basiert auf Materialen aus dem Sammelband "Die Parteivorsitzenden der Bundesrepublik 1949-2005" (Wiesbaden 2005), aus der Reihe "Göttinger Studien zur Parteienforschung".