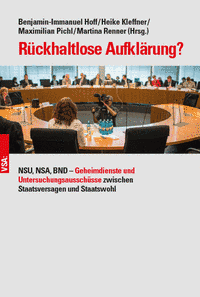Wie stabil wird Jamaika sein?
Noch am Wahlabend des 24. September zogen der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und stellvertretende Parteivorsitzende, Manuela Schwesig, und der bisherige Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Thomas Oppermann, die Reißleine: die SPD steht für eine Bundesregierung nicht zur Verfügung. Sie nimmt die Oppositionsführerschaft an - und setzt damit sowohl Bündnis 90/Die Grünen als auch die FDP aber auch die Unionsparteien enorm unter Zugzwang.
Nicht allein die SPD ist auf einen historischen Tiefstand gefallen - auch CDU und CSU müssen erhebliche Einbußen vergegenwärtigen. Innerhalb der CDU rumort es nach diesem Wahlergebnis wieder spürbarer und dem CSU-Parteivorsitzenden Seehofer sitzt der ambitionierte Anwärter auf die Nachfolge, Markus Söder, im Nacken. Der monatelang offen ausgetragene Konflikt der beiden Unionsparteien in der Flüchtlingspolitik hat möglicherweise dauerhaft das Bild einer Entfremdung unter den Schwesterparteien erzeugt. Streit zwischen den Unionsparteien würde dann nicht mehr als handfester Ausdruck praktizierter Arbeitsteilung gewertet, sondern zunehmend mühsamer zusammengehalten wird, was vielleicht nicht länger zusammen gehört. Mehr als zwei Drittel aller Wahlberechtigten (67 Prozent) meinten laut Infratest dimap am Wahltag, „CDU und CSU passen nicht mehr so gut zusammen wie früher“, unter den Unions-Wähler/-innen ist mit 55 Prozent die Mehrheit ebenfalls dieser Auffassung. Die CSU-Landesgruppe in der Union ist auf die 46 in Bayern direkt gewählten Abgeordneten geschrumpft. Der CSU-Listenkandidat und bisherige bayerische Innenminister Joachim Herrmann verpasste den Einzug in den Bundestag, so dass der bisherige Bundesverkehrsminister Dobrindt die Landesgruppe führen soll.
Die FDP feiert zwar ein furioses Comeback, gleichwohl gehört zur kollektiven Erinnerung der Liberalen der schmachvolle Rauswurf aus dem Bundestag 2013. Zwar gaben 70 Prozent der befragten FDP-Wähler/-innen bei der Bundestagswahl 2017 gegenüber Infratest dimap an, dass das Votum für die Liberalen dazu dienen sollte, eine weitere Große Koalition zu verhindern, doch die 51 Prozent, die nach dem Ende der schwarz-gelben Koalition meinten, dass die Liberale Partei in Deutschland nicht mehr gebraucht werde, steckt der FDP noch in den Knochen. Die negative Bewertung der FDP 2013 war zudem kein singulärer Ausreißer, sondern zeichnete sich bereits länger ab. In den Augen der Wahlberechtigten versprach die Partei „seit Jahren mehr als sie hält“. Bereits im Januar 2012 stimmten 83% der von Infratest dimap befragten Deutschen dieser Aussage zu. Eine ebenso große Zahl hielt im Mai 2011 die FDP für wenig bzw. gar nicht glaubwürdig und im Januar 2011 kritisierten 72% der Befragten, dass die FDP vor allem Politik für bestimmte Wählergruppen mache, also das Allgemeinwohl vernachlässige. Kurzum: Das Dilemma der FDP bestand 2013 in der Entkopplung zwischen dem normativen Bild, das Bürgerinnen und Bürger von einer liberalen Partei zeichnen und der Sichtweise auf die FDP. Laut dem Institut für Demoskopie sahen vor vier Jahren zwar 27% der wahlberechtigten Bürger/-innen die Existenzberechtigung einer liberalen Partei, doch nur 19% eine Existenzberechtigung für die FDP. Es ist anzunehmen, dass dem charismatischen Parteivorsitzenden der FDP, der die Partei als one-man-show wieder aufgerichtet hat, diese fragile Ausgangsbasis ebenso klar ist, wie der Umstand, dass fast 60 Prozent der FDP-Wähler/-innen laut Infratest dimap die Meinung vertreten, die FDP habe ohne Christian Lindner keine Chance und 42 Prozent ohne ihn die FDP nicht gewählt hätten. Bezogen auf alle Wahlberechtigten geben sogar 70 Prozent der Befragten an, dass die FDP ohne Lindner keine Chance habe. Erschwerend kommt hinzu, dass die FDP-Bundestagsfraktion, die sich zunächst neu konstituieren muss, fast gänzlich ohne Regierungserfahrung zusammengesetzt ist - vielfach auch nur mit eingeschränkter Kenntnis des parlamentarischen Geschäfts.
Ganz anders die grüne Bundestagsfraktion, die funktionsfähig ist und mit einem besser als erwarteten Wahlergebnis im Rücken gestärkt in Sondierungsgespräche geht, auch wenn der Konsens über ein solches Regierungsbündnis innerparteilich noch bei weitem nicht in trockenen Tüchern ist. Laut Infratest dimap sind 53 Prozent der Wahlberechtigten der Meinung, dass so wie die Grünen sich entwickelt haben, „passen sie als Koalitionspartner jetzt auch zur Union“. Von den Wählerinnen und Wählern sind 79 Prozent dieser Auffassung. Mehr als die Hälfte der Infratest dimap-Befragten(52 Prozent) fänden es begrüßenswert, wenn die Grünen an der Regierung beteiligt wären. Dies entspricht zwar fast exakt dem von Infratest dimap gemessenen Wert bei der Bundestagswahl 2013 (53 Prozent), doch hat sich das Bild von den Grünen offenbar im Hinblick auf das Erfordernis der nächsten Regierungsbildung gewandelt - sie sollen nun regieren.
Spannungsreiche Sondierungen aber eher FDP-Tolerierung einer schwarz-grünen Minderheitsregierung als GroKo 3.0 oder Neuwahlen
Sofern eine Große Koalition oder eine Koalition aus Union und SPD, wie man im Hinblick auf alle drei geschrumpften Parteien künftig passender formulieren sollte, nicht möglich sei, präferierten bereits in der Woche vor der Wahl die von den Instituten Befragten ein sogenanntes Jamaika-Bündnis als zweitbeste Option.
Innerhalb der vier beteiligten Parteien werden Sondierungen zum Zweck einer Regierungsbildung zwar vorgesehen, doch stößt die Unvermeidlichkeit, mit der diese Sondierungen zu einer Koalition führen müssen, auf Bedenken. Diese drückt sich einerseits in Kritik an der SPD-Absage für eine mögliche Regierungsbildung aus bzw. in der Erwartung, dass man auch mit der SPD entsprechende Gespräche führen werde oder andererseits an mehr oder weniger deutlicher Kritik an einer Jamaika-Koalition.
Der Thüringer FDP-Landesvorsitzenden und nunmehr in den Bundestag gewählte Abgeordnete, Thomas Kemmerich wird mit den Worten zitiert: "Um es im saloppen Politikjargon zu sagen: wer sich mit dieser Bundeskanzlerin ins Bett legt, kommt darin um". Die einzige direkt in den Bundestag gewählte Abgeordnete der Grünen, Canan Bayram will ein Jamaika-Bündnis nach eigenen Angaben nicht unterstützen und lässt verlauten: "Ich kann nicht sehen, welche Parallelen wir mit der CSU oder der FDP haben".
Solche Aussagen dürfen nicht überbewertet werden, insbesondere bevor die Sondierungen überhaupt begonnen haben und mit jedem Tag der Verhandlungen Erwartungshaltung, Verbindlichkeit und Gewöhnung dazu beitragen, dass ein Koalitionsschiff, das erst einmal Fahrt aufgenommen hat, in der Regel auch sicher in den Hafen einläuft. Sie können aber dazu beitragen, das wichtigste Schmiermittel in Verhandlungen, das Vertrauen auf zielorientierte Ergebnisse, zu unterminieren. Das notwendige Gegenmittel dazu: ein gutes Verhältnis unter den Spitzenakteuren. Dass die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und die Kanzlerin herkunftsbedingt "einen Draht zueinander" haben, ist allgemein bekannt. Der Umstand, dass der Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier, bereits in den 1990er Jahren die sogenannte Pizza-Connection, einen schwarz-grünen Gesprächskreis, ins Leben rief, dürfte ebenfalls zum Vorteil gereichen. Mit dem Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, der einer grün-schwarzen Koalition vorsteht, ebenso wie mit dem nur knapp an der innerparteilichen Auswahl zum Spitzenkandidaten gescheiterten Robert Habeck, der seit Kurzem in einer Jamaika-Koalition mitwirkt, steht Personal zur Verfügung, dem es möglich ist, Gesprächsfäden zu knüpfen, die das stabile Netz von Sondierungen und Koalitionsverhandlungen sind. Selbst die Zusammenarbeit von FDP und Grünen in der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz dürfte genutzt werden, um die grün-gelben Gegensätze mit dem Ziel einer Einigung zu überbrücken.
Denn ein Scheitern - so viel ist klar - können sich die vier Parteien nicht leisten. Dass die SPD sich als Westentaschenreserve der Union hergibt, sollten die Unionsparteien, FDP und Grüne nicht zu einer Koalition zusammenkommen, kann ausgeschlossen werden. Eher ist anzunehmen, dass die FDP den drei Partnern die Tolerierung einer Minderheitsregierung anbietet. Das Vorbild für eine solche FDP-Tolerierung von schwarz-grün wäre ironischerweise die PDS-Tolerierung der rot-grünen Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt, die als "Magdeburger Modell" in die Parteiengeschichte der 1990er Jahr einging.
Nachfolgend sollen jedoch nicht die Funktionsbedingungen einer stabilen Minderheitsregierung diskutiert werden, darauf wurde durch den Autor an anderer Stelle im Zuge der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bereits eingegangen. Vielmehr wird die verbreitete Annahme, Mehrparteien-Koalitionen seien naturgemäß instabiler als andere Bündnisse, einer kritischen Betrachtung unterzogen und im Ergebnis die Auffassung vertreten, dass es für diese Annahme keinen hinreichenden Beleg gibt.
Komplexe Koalitionen – nicht zwangsläufig instabil
Im Mehrparteiensystem, in dem die Fragmentierung auch die Parlamente erreicht - erstmals seit 1953 sind sieben Parteien im Bundestag vertreten - nimmt die Wahrscheinlichkeit von Drei-Parteien-Konstellationen in den Ländern und Vier-Parteien-Koalitionen, sofern mit den zwei Unionsparteien regiert wird, zu. Gleichwohl werden auch Zwei-Parteien-Bündnisse oder sogar Alleinregierungen – entgegen mancher Unkenrufe weiterhin zum Set der Regierungsbildungen auf Landesebene gehören werden. Angesichts dessen überrascht es, wie verbreitet in Deutschland weiterhin die Vorstellung ist, Mehrparteien-Bündnisse seien instabiler als andere Regierungsmodelle.
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass Regierungsbündnisse durch einen Doppelcharakter geprägt werden: „Sie sind einerseits Kooperationsbündnisse (auf Regierungsebene), andererseits besteht die Konkurrenzbeziehung der Partner fort (auf der Ebene des Parteiensystems).“ (Heinrich 2002: 16) Mit jedem weiteren Partner erhöht sich folglich die potentielle Krisenanfälligkeit des Regierungsbündnisses durch das besondere Interesse der Parteien an Koalitionskonflikten, in denen sich „die Diskrepanz zwischen Koalitionsloyalität und Profilbildung der Parteien“ (Ebd.) konstituiert.
Inwieweit „komplexe Koalitionen“, wie Klecha (20011: 334ff.) diese Bündnisse bezeichnet, tatsächlich instabiler oder – noch schwerwiegender für die an Stimmenmaximierung interessierten Parteien – für die beteiligten Akteure nachteilig sind, bedarf also einer Evidenzprüfung.
Zunächst lässt sich feststellen: In jeder Bundesregierung unter Einschluss der Union regieren bereits bisher drei Parteien miteinander. Obwohl die beiden Parteien in einer besonderen Form der auch institutionellen Zusammenarbeit miteinander stehen, können CDU und CSU nicht zwangsläufig in Eins gesetzt werden. Instabil im Sinne eines Koalitionsbruchs mit vorzeitigen Neuwahlen waren diese Bündnisse in den bisher mehr als 35 Regierungsjahren seit 1957 nicht. Abgesehen vom fliegenden Regierungswechsel 1966 als in der Legislaturperiode die SPD die FDP im Kabinett ersetzte. Neuwahlen gab es damals nicht.
Dennoch ist der Einwand zutreffend, dass die beiden Unionsparteien durch die Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag einerseits und die Ko-Abhängigkeit beider Parteien hinsichtlich der bundesweiten Wahlergebnisse eine höhere Verschränkung aufweisen, als dies bei anderen Dreier-Konstellationen der Fall wäre. Das Verhältnis der beiden christlichen Schwesterparteien untereinander ist insofern trotz aller inhaltlichen Profilierungsbemühungen seitens der Regionalpartei CSU durch weniger oder andere Konkurrenz geprägt, als zwischen den anderen Akteuren im Parteienwettbewerb.
Trotz der erhöhten Kompetitivität zwischen den Parteien lässt sich die Annahme, Dreierbündnisse auf Landesebene seien grundsätzlich instabil, nicht generalisieren. Gleichzeitig muss konstatiert werden, dass die bisherigen Erfahrungen nicht uneingeschränkt optimistisch stimmen. Einschließlich des r2g-Bündnisses in Thüringen regierten in den Ländern seit 1990 sechs Drei-Parteien-Koalitionen und zwei Minderheitsregierungen mit drei Partnern. Fünf davon zerbrachen vorzeitig: die Ampelkoalitionen in Brandenburg 1994 (Stöss 2010: 172f.) und Bremen 1995 (Roth 1996, S. 272ff.), der Hamburger Senat von Beust aus CDU, Schill-Partei und FDP 2003 (Blumenthal 2004: 271ff.), die rot-grüne Minderheitsregierung in NRW 2012 (Switek 2014) und die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen im Saarland 2012 (Hartmann 2011: 277ff.).
Die Brandenburger Ampelkoalition hielt von immerhin von Oktober 1990 bis Anfang 1994, nur die restlichen 5 Monate bis zur Landtagswahl regierte die SPD allein mit der FDP. Verantwortlich für die vorzeitige Beendigung der Koalition war die Debatte über eine mögliche Stasi-Vergangenheit des Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Bereits 1992 verließ die spätere Stasi-Unterlagenbeauftragte Marianne Birthler die Regierung, doch erst zwei Jahre später zog sich auch Günther Nooke zurück.
Die Amtszeit der Bremer Ampelkoalition (Roth 1991: 281ff.) umfasste ebenfalls den größten Teil der 13. Wahlperiode von 1991 bis 1995. Sie zerbrach sieben Monate vor dem regulären Ende an der „Piepmatz-Affäre“, die Ausdruck dafür war, dass „die Landesregierung aus SPD, FDP und Grüne, anfangs noch als innovatives Politikmodell gepriesen, sich zunehmend mit selbst [beschäftigte] und zerrieb in internen Konflikten“.
Der erste Senat unter Ole von Beust markierte den Einstieg der drei Legislaturperioden umfassenden CDU-Regierung in der traditionellen SPD-Hochburg Hamburg. Das Scheitern der schwarz-gelben Regierung mit Beteiligung der Schill-Partei basierte vorrangig auf der destruktiven Dynamik dieser rechtspopulistischen Protestpartei und ihres letztlich selbstzerstörerischen Vorsitzenden Ronald Schill. Die aktuelle Verfasstheit der Thüringer AfD, aus deren Landtagsfraktion binnen weniger Monate drei Abgeordnete ausgetreten sind hätte jede Regierungskonstellation, auf die der CDU-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, Mike Mohring, zur Verhinderung der Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten spekulierte, in gleich kurzer Zeit an den Rand des Scheiterns gebracht.
Selbst die Gründe für die Beendigung des Jamaika-Bündnisses im Saarland sprechen möglicherweise weniger gegen die grundsätzliche Stabilität einer komplexen Koalition als vielmehr dafür, dass ein solches Bündnis unter den beteiligten Parteien eine hinreichend große Schnittmenge an Gemeinsamkeiten haben muss. Auch wenn Personalquerelen in der notorisch zerstrittenen FDP von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer als Ursache für die vorzeitige Aufkündigung des Bündnisses genannt wurden, benennen Lohse/Wehner eine grundsätzliche Schwäche sowohl der Ampel- als auch der Jamaika-Koalition: „Grüne und FDP können kaum miteinander, haben lange den anderen als Feindbild kultiviert“.
Die rot-grüne Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt unter Tolerierung der PDS regierte von 1994 bis 1998 (Renz/Schieren 1997: 391ff. und kritisch dazu: Steffani 1997: 717ff.). Nachdem die Grünen aus dem Landtag ausschieden, setzten beide Parteien das Tolerierungsmodell bis 2002 fort(Schieren 1999: 56ff.). In der ersten Wahlperiode dieses legislativ-exekutiven Dreierbündnisses bildete sich „ein Politikstil heraus, der es zuließ, parlamentarische Mehrheiten zu Sachfragen zu mobilisieren“ (Thomas 2003: 799) – ohne dass dabei parteipolitische Aspekte völlig ausgeblendet wurden. In der zweiten Wahlperiode differenzierte sich die Zusammenarbeit zwischen den nur noch beiden Parteien zu einem „gouvernementalen Verhandlungssystem“ (Thomas) aus, das „über den ursprünglichen Ansatz weit hinaus ging“ (ebd.: 806). SPD, PDS und die Landesregierung interagierten in einer Weise, so dass auch wechselnde Mehrheiten bei wichtigen Themen, die auf Dauer angelegte Zusammenarbeit nicht in Frage zu stellen vermochte.
Demgegenüber kann mit Blick auf die Minderheitsregierung in NRW unter Hannelore Kraft festgestellt werden: Düsseldorf ist nicht Magdeburg (Grunden 2011). Zwar sondierten die rot-grünen Parteien auch mit der Linkspartei, doch waren die Schnittpunkte für ein Bündnis wesentlich größer als insbesondere die Bereitschaft der drei Parteien, diese zur Grundlage des gemeinsamen Handelns zu machen. Eine Lagerkonformität wurde schlicht negiert. Die Minderheitsregierung in NRW agierte deshalb – anders als in Magdeburg – mit wechselnden Mehrheiten. Zwar sah sich die Linksfraktion in der praktischen Landtagsarbeit der rot-grünen Regierung näher als FDP und CDU, doch konstituierte sich daraus kein ständiges Abstimmungsverhalten im Sinne dauerhafter Tolerierung. Stattdessen wurde mit wechselnden Mehrheiten gestimmt (Ganhof et al 2012: 887f.). Zudem optierten SPD und Grüne, denen nur ein Mandat zur absoluten Mehrheit fehlte, von Beginn an auf einen günstigen Punkt für Neuwahlen. In allen Umfragen bestand die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung als stabile Zweier-Koalition.
Es sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass die Aussagekraft der gewählten Beispiele in der Parlaments- und Regierungsforschung nicht unumstritten ist (Vgl. Best 2015: 92ff.).
Fragmentiertes Parteiensystem und externe Disziplinierungsfaktoren
Dennoch regierte, verglichen mit den vorgenannten Koalitionen, das um die Partei der dänischen Minderheit, SSW, erweiterte rot-grüne Bündnis ("Dänen-Ampel") unter Torsten Albig (SPD) über die gesamte Amtszeit geräuschlos. Die beiden rot-grünen Parteien verfügen im Nordwesten über eine gewachsene gemeinsame Regierungserfahrung aus den Jahren 1996-2005 unter Ministerpräsidentin Simonis. Der SSW, der sich lange Zeit eine nur „gouvernementale Ausnahmerolle bei knappen Mehrheitsverhältnissen zugestand und die diesem Fall die Tolerierung SPD-geführter Minderheitsregierungen als Option betrachtete“ (Holtmann 2005: 616ff.), hat diese Zurückhaltung aufgegeben, jedoch nur im lagerkonformen Rahmen, also zugunsten von Rot-Grün.
Die sogenannte Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt, bestehend aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen stellt derzeit das Gegenmodell zur "Dänen-Ampel" dar. Die Koalition ist lagerübergreifend zusammengesetzt und in den jeweiligen Koalitionsparteien hoch umstritten. Die Koalition entstand als Abwehrbündnis gegenüber einer AfD, die bei der vergangenen Landtagswahl zur zweitstärksten Partei wurde. Dass dieses Bündnis gebildet wurde, resultiert aus der ebenfalls kritikwürdigen Annahme, Minderheitsregierungen seien in jedem Falle zu vermeiden. In Folge dessen geriet das Bündnis bereits mehrfach an den Rand ernsthafter Krisen, unter anderem als wesentliche Teile der CDU-Fraktion im Landtag gemeinsam mit der AfD auf deren Initiative hin einen Untersuchungsausschuss "Linksextremismus" einrichteten. Dies war nicht nur ein Schlag ins Gesicht det beiden Koalitionspartner, sondern zugleich ein Verstoß gegen die Festlegung des Koalitionsvertrages, nachdem die Koalitionsparteien im Landtag stets gemeinsam abstimmen. Trotz dessen blieb die Koalition beisammen - aufgrund des externen Zwangs, bedingt durch die Stärke der AfD. Dass eine Minderheitsregierung der CDU im Hinblick auf das Parteiensystem im Land ehrlicher und hilfreicher gewesen wäre, dafür spricht viel. Ebenso dafür, dass die Verfasstheit der Christdemokraten im Land eine hohe Gewähr geboten hätte, dass die Tolerierung im Wesentlichen auch durch die AfD vorgenommen worden und in weiten Teilen der Partei dafür Akzeptanz bestanden hätte.
Während die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen mit knapper Ein-Stimmen-Mehrheit seit nunmehr drei Jahren stabil regiert, sind die drei weiteren Mehrparteien-Koalitionen, das r2g-Bündnis in Berlin, die Ampel in Rheinland-Pfalz und die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein erst seit etwas über einem Jahr bis zu wenigen Wochen im Amt, so dass sich tatsächliche Aussagen über die Stabilität noch nicht treffen lassen können.
Dennoch lassen sich auch aus dieser kursorischen Betrachtung komplexer Koalitionen auf Landesebene einerseits, der Entwicklung des Parteiensystems insgesamt sowie verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen folgende Annahmen für die Stabilität komplexer Koalitionen ableiten:
1. Komplexe Koalitionen sind nicht ihrem Wesen nach instabiler als klassische Zwei-Parteien-Koalitionen. Hier wie dort gibt es die Notwendigkeit der Absprachen, Kompromisse, Interessengegensätze etc. Sofern sie scheitern, liegen die Ursachen im Handeln je eines der Partner begründet, wobei das betreffende Handeln auch vergleichbare Beispiele in Zwei-Parteien-Koalitionen findet also kein Spezifikum der komplexen Koalition darstellen muss.
2. Die Stabilität einer komplexen Koalition, die lagerkonform zusammengesetzt ist, scheint höher zu sein, als im lagerübergreifenden Bündnisfall. Gleichzeitig erhöht sich die Notwendigkeit, für den Wahlerfolg mehr als die eigenen Lagermilieus zu mobilisieren.
3. Die Fragmentierung des Parteiensystems hat in einer Weise zugenommen, dass Drei- oder Mehrparteien-Koalitionen keinen Ausnahmefall, sondern eine gewöhnliche Varianten-Erweiterung der von den Wähler/-innen erwarteten Koalitionsbildung sind. Der Rückgriff auf Beispiele aus Phasen des bundesdeutschen Parteiensystems, in denen solche Bündnisse unüblich waren, ist deshalb möglicherweise nur noch bedingt hilfreich.
4. Die stets riskante Abwägung einer vorzeitigen Parlamentsauflösung mit Neuwahlen übt unter den Bedingungen a) einer fragmentierten Parteienlandschaft, b) einem weiteren Mitspieler im Parteienwettberwerb wie der AfD, die derzeit noch hohe Mobilisierungsfähigkeit besitzt und die etablierten Parteien auf die Plätze zu verweisen in der Lage ist sowie c) fehlenden Koalitionsalternativen auch auf komplexe Koalitionen eine stabilisierende Wirkung aus, die nicht zu unterschätzen ist.
5. Selbst wenn das Instrument der Vertrauensfrage der Kanzlerin oder des Kanzlers bzw. der Regierungschef/-innen in den Ländern in Koalitionen stets das letzte Disziplinierungsinstrument ist und bleiben muss, kann unter bestimmten verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen auch eine Beendigung der komplexen Koalition unter Verzicht auf Neuwahlen vorgenommen werden. Sowohl Hessen als auch Thüringen kennen beispielsweise die "versteinerte Regierung". Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU) hatte seinerzeit zwar seine parlamentarische Mehrheit verloren, nicht aber die Regierungsgewalt. Laut Verfassung blieb seine Regierung so lange im Amt, bis der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Dafür ist in Hessen - im Unterschied zu manchen anderen Bundesländern - die absolute Mehrheit aller Abgeordneten nötig. Bereits zuvor gab es in Hessen einen vergleichbaren Fall, als die SPD-geführte Landesregierung unter Holger Börner ihre Mehrheit verlor und vom 1. Dezember 1982 an nur noch geschäftsführend agierte.
Kurzum: Die Furcht vor komplexen Koalitionen entspringt der pfadabhängigen aber inzwischen anachronistischen Erinnerung an ein Drei- oder Vierparteiensystem, in dem Zweier-Koalitionen oder Alleinregierungen den Regelfall der Regierungsbildung darstellten. Davon ist das bundesdeutsche Parteiensystem weit entfernt. Es bedarf also Koalitionstechniken, die der Komplexität des fragmentierten Parteiensystems angemessen sind. Selbst bedingt lagerübergreifende Koalitionen wie ein Jamaika-Bündnis werden dabei keine Ausnahme sein.
Komplexe Koalitionen zur Abwehr der AfD - möglicherweise mehr Teil des Problems als der Lösung
Problematisch hingegen erscheinen Abwehr-Koalitionen gegen die AfD wie das Kenia-Bündnis in Sachsen-Anhalt. Es könnte - ohne die Arbeit der konkret handelnden Personen diskreditieren zu wollen - sein, dass solche Bündnisse das politische System stärker in Frage zu stellen geeignet sind, als sie zur Lösung von Problemen beizutragen. Zudem verhindern sie möglicherweise notwendige Klärungsprozesse zum Beispiel in der Union im Hinblick auf die AfD.
Ersichtlich gibt es - in Sachsen-Anhalt wie auch in Sachsen relevante Teile der CDU, die die AfD als "Fleisch vom eigenen Fleische" empfinden und ihr näher stehen als SPD und Grünen. Träfe dies zu, wäre es dann nicht - so unangenehm die Vorstellung auch sein mag - langfristig ehrlicher, die CDU würde sich - auf die Gefahr des Verlustes eines relevanten Teil ihres Elektorats - zu einer Zusammenarbeit mit der AfD in Magdeburg und Dresden bekennen als mit SPD und/oder Grünen zu koalieren aber mit der AfD auf Kosten der Koalitionspartner zu flirten?! Die CDU könnte z.B. allein eine Minderheitsregierung bilden und sich von der AfD tolerieren lassen. Oder sie würde - wenn sie diese Zerreissprobe scheut - gemeinsam mit der SPD eine Minderheitsregierung bilden, die auf die Stimmen der Grünen und in Einzelfällen selbst der Linkspartei angewiesen wäre. Dies würde jedoch bedeuten, dass die Grünen für sich die Entscheidung treffen, ob und wie wohl sie sich in diesem Bündnis fühlen - ebenso natürlich auch die SPD, die dieses Bündnis nicht zuletzt, genauso wie die Grünen aus staatspolitischer Verantwortung einzugehen bereit war.
* * *
Beitrag auf dem Blog von www.freitag.de vom 25. September 2017

Ich bin Vater, Politiker und Sozialwissenschaftler. Herausgeber von "Neue Wege gehen. Wie in Thüringen gemeinsam progressiv regiert wird" (VSA-Verlag 2023).
Hier veröffentliche ich regelmäßig Beiträge in meinem Blog und andere Publikationen.