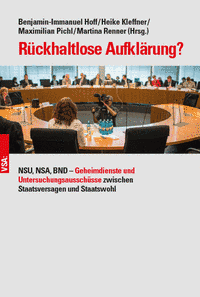Wandel in den Großstädten
Beitrag von Benjamin Hoff zu den Linkspartei-Ergebnissen ostdeutscher Landtagswahlen im NEUEN DEUTSCHLAND
Die Wahlergebnisse des letzten Sonntags verweisen sowohl auf strukturelle Veränderungen in der Parteienlandschaft als auch darauf, wie sich innerparteiliche Debatten der Linken in der Öffentlichkeit auswirken können. Nachfolgend einige Thesen:
Verlierer sind die Großparteien
Ein augenfälliges Ergebnis der Landtagswahlen lautet: Die Großparteien sind die Verlierer. In beiden Ländern haben die etablierten Parteien sowohl an das Spektrum der Nichtwähler verloren als auch an die Gruppe der »sonstigen Parteien«. Aufgrund ihrer Struktur und ihrer Rolle im ostdeutschen Parteiensystem ist neben SPD und CDU auch die Linkspartei von diesem Trend betroffen. Die Gründe für Wahlenthaltung sind vielfältig. Allgemein gelten als Gründe:
Das Verständnis dafür, dass Wählen in einer Demokratie zur Bürgerpflicht gehört, ist seit Jahren und insbesondere bei jungen Menschen rückläufig.
Immer weniger Menschen identifizieren sich mit einer Partei und wenn doch, dann nicht mehr so intensiv.
Nicht nur politisch Uninteressierte üben Wahlenthaltung, auch bei den politisch Interessierten ist die Wahlbeteiligung rückläufig.
Während sich Einstellungen zum politischen System und seinen Institutionen eher langfristig und diffus herausbilden, sind Einstellungen gegenüber den Leistungen und den Akteuren des politischen Systems eher kurzfristig wandelbar und vom jeweiligen Output abhängig. Es ist jedoch zu beobachten, dass auch diese langfristigen Bindungen sich wandeln.
Das Vertrauen in die Institutionen nimmt generell ab. Im Osten viel stärker als im Westen. Abnehmendes Vertrauen in die Regierung korrespondiert mit einer wachsenden Abkehr vom politischen System der Parteipolitik. Zwei Drittel äußern in Befragungen die Auffassung, dass die Probleme in Deutschland so groß sind, dass keine Partei sie lösen könne. Mit der Bildung der großen Koalition sind auch Alternativen verschwunden die Funktion der Landtagswahl als Bundestestwahl macht keinen Sinn mehr, da es weniger Opposition zu wählen gibt.
Für den Osten gilt, das haben die Landtagswahlen ebenfalls gezeigt: Es gibt kein stabiles Drei-Parteiensystem mehr. In Mecklenburg-Vorpommern hat die FDP den Einzug in den Landtag geschafft, der sich bereits 2002 und 2005 angekündigt hatte. Auch in Thüringen und Brandenburg wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Grüne oder Liberale dort den Einzug in den Landtag schaffen.
Damit verändern sich die bisher stabilen Koalitionsoptionen zwischen Rostock und Suhl, auch für Linkspartei und SPD. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin ist die Linkspartei auf ein Bündnis mit der SPD angewiesen, will sie nicht dauerhaft oder wieder in die Opposition gehen. In den drei südostdeutschen Ländern stellt sich die Sachlage anders dar. In Brandenburg als stärkste Partei und in den Ländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen als jeweils kleinere Partei hinter der Linkspartei ist die SPD bislang an ein Bündnis mit der CDU gebunden. Eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei in den drei letztgenannten Ländern ist derzeit prozentual nicht möglich und bereits die Idee stößt auf eine erhebliche psychologische Schwelle bei den potenziellen Partnern SPD und Grüne. Weil jedoch für die nächsten Jahre nicht auszuschließen ist, dass die Linkspartei in Ländern wie etwa Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt erneut stärker wird als die Sozialdemokratie, muss eine Debatte über die Normalität eines linken Ministerpräsidenten und eine von der Linkspartei geführte Koalition angeschoben werden.
Auch im Westen könnten sich die Optionen und »Normalzustände« verändern. Niemand kann vor dem Hintergrund der 17 Prozent Linksparteistimmen bei der Bundestagswahl 2005 auf Landesebene ausschließen, dass bei der Landtagswahl im Saarland 2009 die Linkspartei in den Landtag einzieht und mit ihren Stimmen einer SPD wieder zur Regierungsmehrheit verhelfen könnte.
Kurz: Ohne eine solche Normalisierung werden nicht nur die Regierungsoptionen der Linkspartei, sondern auch die der SPD und damit ihr Verhandlungsspielraum dauerhaft erheblich eingeschränkt bleiben. Die SPD könnte in Ostdeutschland nur noch wählen zwischen der Hoffnung auf Bündnisse mit der Union oder dem Gang in die Opposition, da eigene Mehrheiten unwahrscheinlich sein werden.
Deutliche Veränderungen, die sich auch auf Wahlergebnisse auswirken, sind seit einiger Zeit in den Großstädten zu beobachten. Wesentlich sind die altersstrukturellen Veränderungen: Die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahren wird bis 2020 im Osten bis zu 30 Prozent und im Westen um rund 18 Prozent zurückgehen. Und: Die Zahl älterer Menschen über 60 Jahre wird im Osten wie im Westen stark zunehmen.
Für die PDS bedeutet diese Entwicklung schon jetzt: Es gibt mittlerweile einen »Sterbeüberhang«, der durch Erstwähler nicht aufgefangen wird. Dieser Trend könnte durch absinkende Geburtenrate und die Abwanderung von jüngeren Menschen sogar noch verstärkt werden. Wenn dann, wie bei der Berliner Wahl 2006, bei jüngeren Wählern noch die politisch-motivierte Abwanderung dazukommt, ist ein erneuter Einbruch durchaus realistisch. Zur Erinnerung: Die Linkspartei hat am vergangenen Sonntag bei den unter 30-Jährigen 14 Prozent und bei den 30- bis 44-Jährigen 15 Prozent verloren.
Innerhalb der Linkspartei wird seit längerem darüber diskutiert, dass vor allem in bestimmten innerstädtischen Gebieten die Zustimmung gegenüber den neunziger Jahren abgenommen hat. Dafür werden folgende Gründe genannt: In einigen Gebieten ostdeutscher Großstädte hat in den vergangenen Jahren ein beschleunigter Bevölkerungsaustausch stattgefunden, der zu deutlichen sozialen und demographischen Veränderungen führte. Dieser Bevölkerungsaustausch hat zwar unterschiedliche Geschwindigkeiten, die von stadtentwicklungspolitischen Rahmenbedingungen (etwa Milieuschutz, Sanierungsgebiete) abhängig sind. Im Zuge des beobachteten Sozialwandels findet aber auf jeden Fall eine Veränderung der Bedürfnisse und Prioritäten bei Wählern statt: Themen der kulturellen Modernisierung werden wichtiger eingeschätzt als Fragen der Umverteilung. Außerdem wächst auch die Zahl derer, die staatlicher Intervention kritisch gegenüberstehen.
Die Veränderungen können dazu geführt haben, dass die Hochburgen der Linkspartei mittlerweile zu instabil sind, um auf dieser Basis gute Wahlergebnisse zu realisieren und sich ehemals linke Wähler eher für einen Wechsel zu SPD und Grünen entscheiden.
Umgekehrt hat die Berlin-Wahl gezeigt, dass ein Eindringen in das grüne Milieu für die Linkspartei kaum möglich ist. Der Wähleraustausch in dieser Richtung war marginal. Dies bestätigt eine Forsa-Umfrage aus dem Jahre 2003. Die PDS-Anhänger betrachten die Grünen intensiver als jede andere Partei neben der PDS, sind geneigt, sie zu wählen bzw. haben bereits Grüne gewählt und können sich in relevantem Maße eine grüne Beteiligung an einer SPD-PDS-Regierung vorstellen. Umgekehrt gelingt es der PDS in keiner Weise, eine ähnliche Aufmerksamkeit bei den Grünen-Wähler zu erreichen. Dort ist sie eher das kleinere Übel.
Ob als Reaktion auf diese Entwicklung, der sich die Linkspartei auf jeden Fall stellen muss, eine stärkere Rückbesinnung auf die Rolle als Ost-Partei die richtige Antwort ist, ist noch nicht ausgemacht und könnte sich auch als zu kurz gegriffene Antwort herausstellen.
Die Konflikte zwischen WASG und Linkspartei in Berlin führten dazu, dass der von der Bundestagswahl ausgehende Schub einer gemeinsamen Linken für Ost und West in Berlin vollkommen verpufft ist. Überspitzt ausgedrückt: Im Westen wurde die WASG als West-Linke gesehen und von denjenigen gewählt, die die PDS 2001 in der Sondersituation des damaligen Wahlkampfes wählten und 2005 eine gemeinsame Linke in den Bundestag entsenden wollten. Im Osten wurde die WASG von denjenigen gewählt, die die PDS nicht (mehr) wählen wollten.
Verloren haben letztlich beide. Notwendige Stimmen für soziale Politik wurden verschenkt und es wurden diejenigen abgeschreckt, die Hoffnung in ein gemeinsames Linksprojekt setzen. Der Konflikt zwischen der Berliner Linkspartei und der Berliner WASG ist freilich nur der schrille Ausdruck einer weiterhin unklaren Bezugnahme auf die strategische Selbstverständlichkeit einer Regierungsbeteiligung.
Die Linkspartei ging in die Landtagswahlen vom September 2006 wiederum in einer Situation der Spaltung wie schon bei der desaströs verlorenen Bundestagswahl 2002. Die beiden Landesverbände, die als Vertreter rot-roter Regierungen im Doppelpack antraten, wodurch die Wahlen stärker als Zukunftstest dieses Regierungsmodells wahrgenommen wurden, erhielten nur eine auffällig konditionierte, betont kritisch begleitete und an »Auflagen« für eine Koalitionsneuauflage gebundene verbale Unterstützung. Lothar Bisky hat am Wahlabend völlig zu Recht gesagt: Die Kritik an den PDS-Senatoren aus den eigenen Reihen war ein Fehler. Dazu kam: Parteien und Parteiungen, die man auf Landesebene als Partner hat und braucht, wurden von außen offensiv als »neoliberal« und nicht kooperationsfähig denunziert.
Zwangsläufige Entzauberung
Thomas Falkner ist in seiner Bewertung zuzustimmen wenn er über die Ausgangslage der Berliner Regierungsbeteiligung und die Wahl vom Sonntag schreibt: »In dem enormen Hype von damals einerseits hatte der Bankenskandal die Fortführung der alten, die Stadt fesselnden Großen Koalition unmöglich gemacht und eine völlig neue, starke politische Mehrheit auf die Tagesordnung gesetzt; andererseits hatte die Wendung von der Solidarität mit den Opfern des 11. September 2001 hin zur Abwehr eines Afghanistan-Abenteuers mit deutscher Beteiligung herrschte eine Stimmung in der Stadt, in der alles möglich erschien: Eine neue Politik, die mit allem alten Mist aufräumt. Ein Zeichen, das Deutschland und die Welt versteht: Wir in Berlin, wir, die Abhängigen und Geteilten jetzt zeigen wir es allen. (...) Und der Gysi-Wahlkampf war ein Wahlkampf der Euphorie und der Versprechungen gegen den Impetus der Nüchternheit und Sachlichkeit, für den Harald Wolf stand. Diese Blase war im Grunde genommen schon mit dem Rücktritt von Gregor Gysi ein knappes Jahr später geplatzt ein Vorgang, der die Anhänger der Berliner PDS bis ins Mark getroffen hatte und bis heute nicht vergessen ist.«
In Mecklenburg-Vorpommern 2002 wie nun in Berlin 2006 hat die PDS am Ende der ersten Legislaturperiode in Regierungsverantwortung einen deutlichen Stimmeneinbruch hinnehmen müssen. Dahinter steht zum einen das Problem, das man in einer Regierung Verantwortung für das Ganze übernommen und sich also für Interessenabwägung und -ausgleich, für Kompromisse und Verzicht auf eigenes, für Streckung eigener Ziele und Konzentration auf Vorrangiges einzusetzen hat. Damit waren große Teile der Ost-Berliner Milieus und der gerade zur Hoffnungsträgerin PDS gestoßenen Wähler nicht einverstanden. Viele setzten die eigenen Interessen und Werte als das für alle »Vernünftige« und Richtige und nahmen es der Linkspartei und dem demokratischen Parteiensystem übel, dass ihre Ziele nicht ausreichend zum Tragen kamen.
Probleme als Juniorpartner
Es ist richtig, die PDS hatte Probleme als Juniorpartner, sie hatte geringere Regierungserfahrung als der größere Koalitionär, ein diffiziles Heimatmilieu und Schwierigkeiten beim Akzeptieren der Regierungsrolle. Die Berliner Koalition und die PDS in ihr hat aber insbesondere zu lange gebraucht, um über die Sanierung des Landeshaushaltes hinaus eine verbindende und öffentlichkeitswirksame Erzählung der Berliner Koalition zu entwickeln. Gelungen ist ihr dies nicht. Im Gegenteil: Die Linkspartei wurde mit dem Sparen identifiziert und zu wenig mit den sozialen Errungenschaften, die Bestandteil der Regierungsarbeit waren.
Horst Kahrs, Bereichsleiter Strategie und Politik beim Linkspartei-Parteivorstand, schlussfolgert daraus: »Die Chance der Linken besteht in zweierlei: in der lösungsorientierten Zuspitzung auf Phänomene, die in der Alltagswahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger präsent sind; und in der Wahrnehmung: Die trauen sich wenigstens was. Wenigstens die legen sich mit den Mächtigen an. Und die Linken nehmen es ernst, dass für die Rahmenbedingungen, die Gesetze immer noch die Politik zuständig ist und nicht die Konzerne selbst. Die Linken pochen nicht auf den abstrakten Staat, sondern auf die Handlungsfähigkeit der Politik, des politischen Systems, der Demokratie.«
Und im Nordosten? Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren waren in der rot-roten Regierung Abnutzungserscheinungen zu erkennen. Eine Verständigung über Perspektiven eines »politischen Projekts SPD-PDS-Koalition« erfolgte lange Zeit nicht. Und es war nicht deshalb auch nicht zu erwarten, dass Ringstorff im Landtagswahlkampf mit einer klaren rot-roten Perspektive agieren würde.
Was kann aus den Landtagswahlen vom letzten Sonntag gelernt werden? Die Linkspartei hat sich das »strategische Dreieck« in einer länger währenden Debatte erarbeitet und auf dem Potsdamer Bundesparteitag 2004 mit Mehrheit angenommen. Diese Überzeugung, dass für sozialistische Politik nach unserem Verständnis Widerstand und Protest, der Anspruch auf Mit- und Umgestaltung als Beteiligungen an Regierungen sowie über den Kapitalismus hinaus weisende Alternativen ein unauflösbares strategisches Dreieck bilden, ist keine Floskel, sondern sinnvolle Übersetzung linker Strategie. Über die Bedeutung des »strategischen Dreiecks« gibt es zudem Übereinstimmung in den Kooperationsvereinbarungen mit der WASG.
Ein Verlust beider Regierungsbeteiligungen wäre für den weiteren Parteibildungsprozess schädlich. Die Linkspartei wäre in der Wahrnehmung Vieler zurückgeworfen auf eine Situation vor 1998. Problematisch ist vor allem das Signal: »Die kommen nicht auf einen grünen Zweig.«
Deshalb also aus nahe liegenden Gründen politischen Verstandes und solchen der innerparteilicher Solidarität muss es in den kommenden Wochen darum gehen, die beiden Linkspartei-Landesverbände bei ihren Sondierungsgesprächen zu unterstützen und ihnen Rückhalt auch und gerade für Koalitionsverhandlungen zu geben. Gespräche mit der SPD sind schwer genug gegen die eigene Partei sind sie unmöglich.
Der Autor ist Leiter der Bund-Länder-Koordination der Linksfraktion im Bundestag.