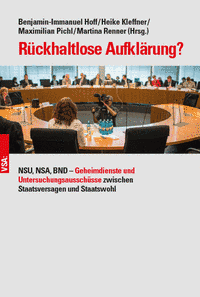Plädoyer für die Intellektuellen
Beitrag auf dem Blog von www.freitag.de vom 8. März 2018
Jedes Jahr aufs Neue lädt die Klassik Stiftung Weimar am 16. Februar zum Jahresempfang. Dies ist traditionell der erste Höhepunkt im kulturpolitischen Jahreskalender Thüringens. Anlass des Empfangs ist stets der Geburtstag von Großherzogin Maria Pawlowna. Am diesjährigen 232. Geburtstag Maria Pawlownas war ein weiteres Ereignis zu feiern: die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel, der nach einem Jahr ohne Anklage aus der türkischen Untersuchungshaft entlassen wurde. Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Sieg der Freiheit über Illiberalismus. Der Jahresempfang markiert insoweit bereits Aspekte dieses an Jahrestagen reichen 2018. Im Widerschein dieser Jahrestage die geistigen Magazine unseres Landes und insoweit natürlich diejenigen der Klassik Stiftung Weimar einer Inventur zu unterziehen, ist Gegenstand des hier vorliegenden Beitrags.
Nun ist eine Inventur im Rechnungswesen zunächst nicht mehr und nicht weniger als die Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände und der Schulden an einem Stichtag. Und der italienische Mathematiker Luca Paciolo, der schon 1494 forderte, dass jeder Kaufmann „zuerst auf einem Blatt oder in einem besonderen Buch das einschreibt, was er in der Welt an Immobilien und Mobilien zu besitzen glaubt“, erkannte bereits, dass die Inventur ebenso notwendig sei, wie sie auch den Handel beim Geschäft zu beeinträchtigen in der Lage sein könne.
Was aber, wenn das ganze Geschäft unserer liberalen Demokratie zunehmend leer läuft? Was, wenn die Inventur der geistigen Magazine der Klassik Stiftung Vermögenswerte vermerkt, deren Wert allein in der musealen Bedeutung für den – ich komme später noch einmal auf den Begriff zurück – „Memorialort Weimar“ gemessen wird?
Es wäre die konsequente Fortsetzung narrativer Leere und beredter Sprachlosigkeit, die zum Muster unpolitischer Politik geworden ist. Ein Ergebnis eines sachzwanglogischen „there is no alternative“-Diskurses, in dem Narrative, also „Große Erzählungen“, entweder mit dem Ideologievorwurf erschlagen oder als unzeitgemäßer Holismus verächtlich gemacht wurden.
Fatale Aussage: Wer Visionen hat soll zum Arzt gehen
Die Hyperkomplexität der Gegenwart mache es unmöglich, so der professionelle Einwand gegen den Wunsch nach integrativen großen Erzählungen, politisches Alltagsmanagement an Langzeitvisionen auszurichten. Oder mit den Worten des Altkanzlers Schmidt: „Wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen.“ Im Interview mit dem ZEIT-Herausgeber Giovanni di Lorenzo sagte Schmidt viele Jahre später: „ich wurde gefragt: Wo ist Ihre große Vision? Und ich habe gesagt: Wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage."
Ich bestreite, dass die Frage dusselig war. Sie ist im Gegenteil unverzichtbar. Damals und noch mehr heute. Und die Reaktion von Helmut Schmidt auf sie war ebenfalls nicht dusselig – sie war meines Erachtens fatal. In ihr drückt sich über Jahrzehnte falsch verstandene Ideologiekritik aus. Um dem Vorwurf ideologiegetriebener Politik zu entgehen, soll allein „pragmatische Politik“ betrieben werden. Diese habe vermeintlich keine ideologischen Grundlagen, doch lag und liegt ihr nicht weniger als ein auf Staat und Wirtschaft fokussiertes Verständnis zugrunde, in dem von Gesellschaft keine Rede mehr ist und fundamentale Bestandteile des sozialen Lebens, wie Beziehungen, Zugehörigkeitsgefühle, lokale Vertrautheit, soziale Sicherheit aber auch kulturelle Gewissheiten, wie Franz Walter (FAZ v. 02.01.2018) jüngst ausführte, ad acta gelegt wurden.
Danny Michelsen und Franz Walter führen in dem bereits 2013 erschienen Essay „Unpolitische Demokratie“ aus, dass diese Grundbedürfnisse nicht ignoriert werden können. Menschen dazu neigen, die eigene (oder auch fremde) Lebensgeschichte in einen kohärenten Sinnzusammenhang zu bringen, ihr so einen Sinn, einen roten Faden zu geben: „Das Leben als Entwicklungsroman: Entstehung, Werden, Kampf, schließlich Erfüllung als innere Einheit eines fortschreitenden Ganges durch die autobiographische Zeit.“ (Michelsen/Walter 2013: 360)
Im »18. Brumaire des Louis Bonaparte« leitet Marx ein mit der Feststellung: „Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ Und er führt im 2. Absatz fort: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. […] Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neuen Weltgeschichtsszene aufzuführen.“
Die großen politischen Bewegungen unserer Zeit kreierten sich durchweg als Narrative. Und nicht nur möglicherweise ist der dramatische Niedergang der sozialdemokratischen Bewegung, den wir im europäischen Maßstab - 100 Jahre nach der erfolgreichen Novemberrevolution des Jahres 1918 - zu konstatieren haben auch dadurch zu erklären, dass die Sozialdemokratie sich einerseits im keynesianischen Wohlfahrtsstaat der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Tode siegte und es andererseits versäumte, auf diese Siege mit einem neuen Narrativ zu reagieren. Die Sozialdemokratie hat über den Pragmatismus von Helmut Schmidt und die New Labour-Phantasien von Tony Blair über Gerhard Schröder bis zu Lionel Jospin sich sowohl inhaltlich wie normativ entleert und konnte, „im Unterschied zu ihrer Glanzzeit die je gegenwärtigen Probleme nicht mehr mit eigener Sinnperspektive erklären und mit genuinen Handlungen zielstrebig angehen. Zuletzt hatte sie nicht einmal Ansätze eines zündenden Gegenkonzeptes in der Hand“. (Walter 2018)
Dies Versäumnis beruhte weder auf Schusseligkeit, weil man gerade wichtigeres zu tun hatte, oder Dusseligkeit. Vielmehr war man der Auffassung, die Geschichte sei in gewisser Hinsicht an ihr Ende gekommen. Man sei am Ziel angekommen. Wohlfahrtsstaat, Liberalismus und Demokratie seien „the only game in town“ und unanfechtbar.
Francis Fukuyama machte im Lichte der friedlichen Revolutionen von 1989 die Formel vom Ende der Geschichte in seinem 1992 erschienenen Buch „The End of History and the Last Man“ populär.
Fukuyamas voreilige Diagnose vom Ende der Geschichte
Ein Vierteljahrhundert nach Fukuyamas voreiliger Diagnose vom Ende der Geschichte sieht die Sachlage fundamental anders aus. Die Diagnose auf fünf Punkte gebracht lautet:
- Das Grundvertrauen in die Politik geht seit langem und in jüngster Zeit rasant zurück, weil das sie tragende Wohlfahrtsversprechen, nach dem es der kommenden Generation besser gehen wird als der vorherigen, nicht mehr trägt. Daraus entsteht Desintegration.
- Populisten stellen dem abschmelzenden Grundvertrauen in die Sicherheit der nächsten Generation das Narrativ eines Heartlands, des idealen Herzlandes gegenüber, das von Eliten bedroht wird, weil diese das Herzland fremden und feindlichen Kräften ausliefern.
- Infolgedessen fallen Liberalismus und Demokratie auseinander. Die Demokratie wird als Wille der Mehrheit inszeniert. Gegen diejenigen Institutionen, die dem Schutz der Minderheit und ihrer Artikulationsfähigkeit verpflichtet sind – öffentlich-rechtliche Medien, Parlamente und Gerichte um nur drei Institutionen zu nennen. Gegen „die Eliten“ und gegenüber den Intellektuellen, als Kombattanten und Agenten des Herzland feindlich gegenüber stehenden Kosmopolitismus, der Globalisierung und der Minderheitenrechte. Die Folgen sehen wir in den illiberalen Demokratien Polens, Ungarns oder der Deniz Yücel neben tausenden weiteren Journalisten, Richtern etc. inhaftierenden Türkei. Wer glaubt, Österreich oder Deutschland seien vor einer ungarischen Entwicklung gefeit, ist optimistisch. Ich bin es nicht.
- Die so hergestellte aggressive Distinktion erzeugt eine integrative Wirkung negativer Solidarität gegen „die anderen“, „die da draußen“, „das Fremde“.
- Populismus hat stets zwei Seiten. Er ist einerseits der betrunkene Gast am Tisch, der unbequeme Wahrheiten ausspricht. Er kann Gefahr und Korrektiv der Demokratie sein. Die negative Mobilisierung des autoritären Populismus, der nicht allein im Mantel des Rechtspopulismus auftritt, ist – und hier komme ich auf den Ausgangspunkt und den fatalen Irrtum Helmut Schmidts und seiner realpolitischen Apologeten zurück – eine pathologische Reaktion auf eine unpolitische Politik. Unpolitische Politik deshalb, weil sie keinen diskursiven Raum zur Artikulation politischer Leidenschaft bietet. Diesen sogar regelrecht verweigert und der es deshalb nicht gelingt, ein integrierendes Narrativ zu entwickeln, das gesellschaftlich mehrheitsfähig ist.
Aber, aber, werden jetzt einige beschwichtigend einwerfen – ist die liberale Demokratie nicht Narrativ genug? Ja und Nein. Es gibt, um mit Manfred Schneider zu sprechen, „keine Alternative zu den Errungenschaften und den Fiktionen des ‚als ob‘, die uns die theoretische Vernunft von Kants gegeben hat. Menschenrechte und Menschenwürde beruhen darauf, dass alle Menschen so behandelt werden, ‚als ob‘ sie dieses Recht und diese Würde hätten“. Gleichzeitig ist sie ist so selbsterklärend wie meine genervte Antwort „weil es so ist“ auf gefühlt 10.000 Nachfragen eines meiner Söhne.
Über Jahre haben diejenigen, die Narrative ablehnen und den Sachzwang feierten, all denen, die sich angesichts unsicherer Verhältnisse nach Sicherheit, Beständigkeit, nach – Achtung! – Heimat und Altvertrautem sehnen, das Gefühl vermittelt, sie seien rückwärtsgewandt oder begriffsstutzig. Frei nach dem Motto: „It’s globalization, stupid“. Das Bedürfnis nach Verwurzelung suchte sich so sein Narrativ im populistischen Heartland - „The only Narrativ in town“.
Narrative - kein begrifflicher Hokuspokus
Angesichts dieser evidenzbasierten Erkenntnis widerspreche ich deutlich denjenigen, darunter auch wieder Manfred Schneider, die Narrative als Gerede und begrifflichen Hokuspokus abtun wollen. Sie behaupten, ebenso wie in den 1970ern die „Dialektik“ gehe nun das Wort „Narrativ“ wie Konfetti durch die Debatten, bis der Karneval irgendwann ein Ende findet (Schneider 2018). Also kurzer Hype – bald schon vergessen. Entsprechend erklärte DIE WELT im November 2017 den Begriff zum Modewort und übertitelte einen Beitrag mit „Hinz und Kunz schwafeln heutzutage vom ‚Narrativ‘“. Die NZZ legte ein knappes halbes Jahr später mit dem Gastkommentar „Das närrische Narrativ“ nach. Weitere Beispiele ließen sich problemlos benennen. Für die Begriffe „Narrativ Politik“ benennt Google „ungefähr 574.000 Ergebnisse“.
Wer wie Manfred Schneider Ideen, Argumenten, Ideologien, Interessen, Verblendungen, Kapital und Macht als Streitgegenstände in die politische Arena zurückholen möchte, sollte aufhören, sich gegen das Bedürfnis nach Meta-Erzählungen zu wehren. Zur berechtigt kritisierten Reduktion des politischen Diskurses tragen nicht diejenigen bei, die der Auffassung sind, dass in den Magazinen der sozialen Demokratie ausreichend Material vorhanden ist, gesellschaftliche Integration wiederherzustellen. Dafür ist es freilich erforderlich, sowohl diejenigen Trittbrettfahrer abzuschütteln, die meinen, Narrative seien schöne Blumen zur Verzierung des Agenda-settings unpolitischer Politik als auch diejenigen, die das Fehlen einer integrativen großen Erzählung kompensieren wollen durch Erneuerung verheißende charismatische Politikfiguren. Das ist ein Kurzschluss. Wer glaubt, die heterogenen bis widersprüchlichen Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern ließen sich quasi gleichsam auf der Folie einer Führungsperson zu einem Narrativ verdichten, der irrt.
Diese Vorstellung ist im Übrigen auch für die Parteiendemokratie gefährlich. Das Gegenteil von politischer Pluralität, die eine Stärke von Parteien darstellt, ist in einer neuen Formation erfolgreicher und vermeintlich moderner Parteien zu erkennen, die derzeit in verschiedenen Ländern Europas entsteht. Von der Bewegung der Fünf-Sterne in Italien über Macrons „En Marche“ in Frankreich hin zur „Liste Sebastian Kurz“ oder der „Liste Pilz“ in Österreich. In Deutschland versucht Christian Lindner dies schlecht zu kopieren. All diese Parteien sind zugeschnitten auf eine Führungsfigur, verlangen ganz bewusst Gefolgschaft der Mitglieder statt Diskurs miteinander. Diese Parteien gemein ist, dass sie ihren pluralen Charakter gegen ein autoritäres Konzept eintauschen: die charismatische Führung. Um nicht falsch verstanden zu werden: Parteien werden von charismatischen Führungsfiguren geprägt, die sich nicht zuletzt im demokratischen Wettstreit unterschiedlicher Positionen herausbilden. Genau dieser Wettstreit fehlt jedoch in denjenigen Parteien, in denen die charismatische Führungsfigur durch die Auflösung formaler Koordinationsverfahren und partizipativer Rituale zur zentralen Legitimationsinstanz der Organisation wird. Der Charakter der Partei schrumpft zur Akklamationshülle. Sie sind meiner Meinung nach tendenziell autoritär.
Mut zu Komplexität und Widersprüchen
Die Schlussfolgerung meiner bisher in düsteren Farben gemalten Prognose ist nicht mehr und nicht weniger als ein Plädoyer für die Intellektuellen, für die Artikulation politischer Leidenschaft und den unbedingten Mut sowohl zu Komplexität – einfach ist die Welt eben nicht zu haben und wenn alle in der Mitte stehen wollen, gibt es keine – als auch zu Widersprüchen.
Mit dem »Kosmos Weimar«, der bis heute gültigen der Klassik Stiftung Weimar, über deren Titel inzwischen leider mehr geschmunzelt wird, als das man sich dieser auf 12 Seiten verdichteten „Vision für die Entwicklung der Klassik Stiftung Weimar“ tatsächlich erinnert, liegt eine Zielbeschreibung für die Inventur der hier vorhandenen geistigen Magazine unseres Landes vor. Ich zitiere aus dem Kosmos Weimar:
„Der Klassik Stiftung ist ein einzigartiger Schatz des kulturellen Erbes in Deutschland anvertraut. Die Klassik Stiftung arbeitet im Spannungsfeld zweier thematischer Schwerpunkte – der namengebenden Klassik und der Klassischen Moderne. Die Weimarer Klassik […] gibt das Koordinatensystem vor, in dem sich die Klassik Stiftung bewegt – von den Voraussetzungen und Bedingungen des Entstehens der Weimarer Klassik bis zu den verschiedenen Ausprägungen ihrer Wirkung und Rezeption. Der Schritt in die Moderne […] ist nicht nur als Reflex auf die Klassik aufzufassen. Die Klassische Moderne […], ist wie die Klassik selbst ein Weimarer Ereignis, das die deutsche wie die europäische Kultur und Geschichte bis heute prägt. Genauso aber gilt: Das kulturelle Erbe Weimars und seine Interpretation sind ihrerseits geprägt von der Geschichte des 20. Jahrhunderts. So muss die in Weimar entwickelte Idee der Humanität heute im Licht jenes Zivilisationsbruches reformuliert werden, für den der Name Buchenwald steht und der deshalb ebenfalls mit Weimar verbunden ist. […] Die Klassik Stiftung verfolgt deshalb ein Konzept kultureller Aneignung, das die Historizität kultureller Phänomene reflektiert und die Bedingungen einer auf Identifikation abzielenden Aktualisierung kritisch befragt. Erst im Lichte dieses kritischen Bewusstseins wird die geistige Produktivität der in Weimar bewahrten kulturellen Substanz für die Gegenwart und Zukunft zum Leuchten gebracht.“
Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora, Prof. Knigge, hat diesen von der Klassik Stiftung Weimar verfolgten Anspruch in einem Memorandum zur strategischen Entwicklung für die von ihm geleitete Gedenkstätte Buchwald und Mittelbau Dora auf den Begriff der „historisch-kritischen reflexiven Intervention“ gebracht.
Nicht weniger als das wird benötigt, wenn sowohl der Großherzog von Sachsen Weimar und Eisenach Carl Alexander als auch der 1841 in Jena promovierende Karl Marx in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiern. In diesem Jahr jähren sich die Revolutionsjubiläen von 1848 und 1918, die Ereignisse des Jahres 1968 – irrtümlicherweise vor allem als ein westeuropäisches Ereignis rezipiert, obwohl ohne 65 Jahre 17. Juni 1953 oder den Prager Frühling die Friedlichen Revolutionen von 1989 undenkbar wären, an die im kommenden Jahr zu erinnern sein wird. Neben den beinahe mystischen Revolutionsdaten von 1848, 1918 und 1968 treten Jubiläen, die die Extreme des 20. Jahrhunderts markieren. Denken wir nur an die Machtübernahme der Nationalsozialisten vor 85 Jahren oder den 75. Jahrestag der Kapitulation der Deutschen in der Schlacht von Stalingrad, ein Jubiläum, das uns die Verheerungen der Weltkriege ebenso in Erinnerung ruft wie die Folgen von entfesseltem Nationalismus und von Erlösung versprechenden Ideologien.
Wenn wir uns also der Vielzahl der in diesem Jahr zu begehenden Jubiläen annehmen, wohl wissend, dass nächstes Jahr viele weitere zu feiern sein werden, gerade in Weimar, dann sowohl als Messsysteme für gesellschaftliche Veränderungen als auch als potentielle Reflexionsschübe im Sinne historisch-kritischer reflexiver Intervention. Mit der »Topographie der Moderne« um das ehemalige Gauforum ist ein Programm skizziert, das den schauderhaften Begriff des »Memorialortes Weimar« ablöst und die museal-historisierende Beschäftigung mit dem geistigen Inventar in die Gegenwart schleudert mit dem Zweck, es für die Gegenwart fruchtbar und nutzbar zu machen.
Geistiges Magazin zur Revitalisierung intellektueller Diskursfähigkeit
„Was Substanz haben will, braucht einen Ort, an dem es sich unter berechenbaren Bedingungen diskutieren lässt. Es braucht thematisch verbindliche Fluchtpunkte, von denen aus historisch, soziologisch oder ökonomisch argumentiert werden kann. Es braucht Konsistenz statt Kontingenz“, formulierte Paul Jandl im vergangenen Jahr in dem Gastbeitrag „Das schwierige Geschäft der Intellektuellen in Zeiten der Unübersichtlichkeit“, der in der NZZ erschienen ist.
Das und nicht weniger als das muss Anspruch des Programms der in Weimar versammelten Institutionen sein, allen voran der Klassik Stiftung Weimar. Gerade im Vorfeld des 100. Jubiläums der Entscheidung, Weimar zum Sitz der Nationalversammlung zu machen.
In seinem Buch „Warum Weimar? Wie Deutschlands erste Republik zu ihrem Geburtsort kam“ formuliert Heiko Holste „Eine konkrete Gestalt hatte der ‚Geist von Weimar‘ nie – er ließ sich für vieles nutzbar machen […]. Aber gerade in dieser Vielfalt lag seine integrative Kraft. Weimar war eine Hauptstadt der deutschen Kulturnation gewesen, lange bevor die staatliche Einheit der Nation erreicht war. Deshalb war die Stadt im Frühjahr 1919 ein Identifikationsort für alle Deutschen, unabhängig von ihrer regionalen und politischen Herkunft. Dies konnte keine andere Stadt bieten, die damals als Tagungsort der Nationalversammlung zur Debatte stand.“
Aus gutem Grunde standen auch andere Orte in Thüringen zur Debatte. So bewarben sich sowohl Eisenach als auch Erfurt um die Nationalversammlung. Und Eisenach hätte hervorragende verfassungsgeschichtliche Begründungslinien vorzuweisen gehabt, die heute leider vielfach verschüttet sind. Ich habe im vergangenen Jahr auf der Wartburg, die wie die Universität Jena zu den Leuchttürmen deutscher Kulturgeschichte, dem Ringen um demokratische Kultur gehört und nicht zuletzt Säulen in der historischen Erinnerung an das Haus Sachsen-Weimar und Eisenach sind, über die vom Hambacher Fest überblendeten Verfassungstradition des Wartburgfestes als europäischem Ereignis gesprochen. Die demokratisch-republikanische Richtung, die dort vertreten war und sich in Gestalt von Friedrich Wilhelm Carovés als letzter Redner am zweiten Tag zu Wort meldete, steht bedauerlicherweise im Schatten der heutigen Erinnerungstraditionen an das Wartburgfest steht. Doch gerade Carovés, aber auch die Brüder Follen, knüpften an die positiven Traditionen der französischen Revolution an, beschworen deren humanistische Ideale und traten für Patriotismus ohne Franzosenhass und Antisemitismus ein.
Doch das bleibende und in den demokratischen deutschen Verfassungen nachwirkende Erbe des Wartburgfestes sind die „Grundsätze und Beschlüsse des achtzehnten Oktobers“. Aus dem Entwurf sprechen in Wort und Inhalt wesentliche Beiträge des liberalen Jenaer Philosophieprofessors Heinrich Luden. Wie Peter Kaupp zutreffend feststellt, haben „die oft unklaren, gelegentlich von einem etwas überspannten jugendlichen Idealismus und einem träumerischen, unrealistischen Nationalgefühl getragenen Forderungen des Wartburgfestes von 1817 erst in den Grundsätzen und Beschlüssen ihren konkreten Niederschlag und damit eine zukunftsweisende politische Bedeutung gefunden. […] Die Grundsätze und Beschlüsse wurden bald – über studentische Forderungen hinaus – zu einem ersten geschlossenen Programm des deutschen Liberalismus und zu einem wichtigen Anstoß für den deutschen Verfassungsstaat.“ (Kaupp 2003)
In diesen Grundsätzen, die in der liberalen Atmosphäre Jenas ihren Ursprung haben, sind klassische Forderungen des Liberalismus enthalten, insbesondere die Freiheit der Person, die Sicherheit des Eigentums, die Garantie der Meinungs- und Pressefreiheit oder die Gleichheit vor dem Gesetz. Es kann von diesen Grundsätzen und Beschlüssen bis zu den am 27. Dezember 1848 als Gesetz verkündeten „Grundrechten des deutschen Volkes“, nicht nur eine verfassungstheoretische, sondern auch personale Linie zu den Teilnehmenden des Wartburgfestes und ihrem geistigen Umfeld gezogen werden. Betrachten wir das Wartburgfest durch diesen Filter der verfassungspolitischen Vorreiterfunktion, liegt die europäische Dimension klar auf der Hand. Die 1817 formulierten Grundrechte, die 1848 Gesetzescharakter und 1949 in Deutschland Verfassungsrang erhielten, sind diejenigen Grund- und Freiheitsrechte, die wir inzwischen als Grundbestand des europäischen Werteverständnisses betrachten. Zu Recht. Und sie sind, wie ich bereits ausführte, in Gefahr, von Regierungen wie in Ungarn, Polen oder auch der Slowakei außer Kraft gesetzt zu werden.
Die Klassik Stiftung und die Stadt Weimar sind unter diesen Gesichtspunkten, in Nachbarschaft zur Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora einerseits, der Wartburg-Stiftung anderseits und ihrer exzellenten Einbettung sowohl räumlich wie insbesondere wissenschaftlich und kulturell, mit vorzüglichen Bedingungen ausgestattet, thematisch verbindliche Fluchtpunkte zu erzeugen. Dazu beizutragen, in Zeiten der gefühlten Entwurzelung kulturelle und historische Verwurzelung wieder entstehen zu lassen. Ort zu sein, an dem Mut für langfristige Visionen und große Erzählungen wertgeschätzt aber von den politischen und gesellschaftlichen Akteuren aller Provinienz selbst praktiziert wird.
Der Ort, an dem die unselige Debatte über Leitkultur endlich aufgelöst wird in der überzeugenden Feststellung, dass Kultur nicht über einen Leisten zu schlagen ist, sondern vielfältig und verschlungen und bisweilen höchst widersprüchlich, wie Thea Dorn formulierte und die ruhige Gelassenheit darüber, dass Bewusstsein für Heimat und das Geborgenheitsgefühl zu Hause – selbst in der Fremde zu sein - den Kopf und das Herz öffnen für Neues und Fremdes.
Und wer von dieser Vision nichts hören will oder sie für utopisch hält, der kann ja immer noch zum Arzt gehen.