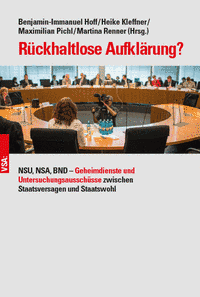Minderheitsregierung statt Neuwahlen
Beitrag auf dem Blog von www.freitag.de vom 20. November 2017
"Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren." Mit diesem Satz erklärte der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner in der Nacht zum 20.11.2017 und nach mehrwöchigen anstrengenden Verhandlungen die Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen für gescheitert. Er dürfte in den Zitatenschatz des bundesdeutschen Politikbetriebs eingehen. Der Satz, das macht ihn so geschmeidig, ist ebenso zutreffend, wie gleichzeitig falsch.
Selbstverständlich ist es richtig, dass eine Opposition aufklärerischer und für das Gemeinwesen sogar wichtiger sein kann, als eine Regierung. Insbesondere, wenn deren innere Widersprüche dazu beitragen, Verdrossenheit über den etablierten Politikbetrieb zu befördern und deren Formelkompromisse notwendige politische Entscheidungen verhindern. Die PDS drückte diese Überzeugung einmal in der Losung aus: "Alle wollen regieren, wir wollen verändern."
Die SPD war in den vergangenen Jahren bis zur Selbstaufgabe bereit, staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen. Nicht zuletzt, weil sie mindestens in gleichem Maße überzeugt war, so gut regieren zu können, dass sie daraus zu alter Stärke zurückkehren und aus der Regierung heraus Kanzlerin Merkel beerben könnte. Nach dem erneut desaströsen Ergebnis bei der Bundestagswahl hat sie nun die weiterhin legitime Entscheidung getroffen, nicht mehr in die Bundesregierung einzutreten. Diese Entscheidung wurde durch einstimmigen Beschluss des Parteivorstandes am 20.11.2017 bekräftigt.
Vermieden werden sollte zudem eine Bundesregierung, die den Eindruck erweckt, nur gebildet zu werden, um sich der AfD zu erwehren. Trotz des Umstandes, dass diese Formation in Sachsen bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wurde, Direktmandate errang und in einzelnen ostdeutschen Ländern bei der Bundestagswahl auf Platz 2 der politischen Kräfte rangierte, handelt es sich im bundesweiten Maßstab weiterhin um eine 10 bis 12 Prozent-Partei. Blicken wir auf das sogenannte Kenia-Bündnis in Sachsen-Anhalt. Es hat nur einen Kitt, der die divergierenden Kräfte zusammenhält: es soll eine Abwehr-Koalition gegen die AfD sein. Es könnte – ohne die Arbeit der konkret handelnden Personen diskreditieren zu wollen – sein, dass solche Bündnisse das politische System stärker in Frage zu stellen geeignet sind, als sie zur Lösung beizutragen. Zudem scheint das Kenia-Bündnis möglicherweise notwendige Klärungsprozesse in der CDU in Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die AfD zu verhindern. Denn ersichtlich gibt es - in Sachsen-Anhalt wie auch in Sachsen - relevante Teile der CDU, die die AfD als "Fleisch vom eigenen Fleische" empfinden und ihr näher stehen als SPD und Grünen. Trifft dies zu, wäre es - so unvorstellbar die Vorstellung auch sein mag - möglicherweise ehrlicher, die CDU würde sich – auf die Gefahr des Verlustes eines relevanten Teil ihres Elektorats – zu einer Zusammenarbeit mit der AfD in Magdeburg und Dresden endlich offen bekennen als mit SPD und/oder Grünen zu koalieren, aber parallel mit der AfD und deren Wählermilieu, das als das eigene verstanden wird, zu flirten.
Die AfD ist von jeder Form machtpolitischer Option auf Bundesebene weit entfernt – allen Schockwellen in den Unionsparteien zum Trotz. Das Ergebnis der Bundestagswahl war nicht mehr und nicht weniger als das erwartbare Ende der Großen Koalition, eines erneut vielfältiger gewordenen Bundestags, da erstmals seit 1953 wieder sieben Parteien im Parlament vertreten sind und der Umstand, dass schwarz-grün ebenso wie schwarz-gelb keine Mehrheit hatten. Dies sollte die Regierungsbildung schwerer aber nicht grundsätzlich unmöglich, zumal die Unionsparteien, FDP und Grüne in den unterschiedlichsten Konstellationen bereits miteinander regiert haben oder regieren. Angesichts dessen die Behauptung aufzustellen, eine Jamaika-Koalition würde solcherart gesellschaftliche Widersprüche vereinen, dass sie unmöglich sei, ist aberwitzig.
Woran scheiterte Jamaika?
Gescheitert sind die Jamaika-Verhandlungen deshalb nicht an vermeintlich unvereinbaren gesellschaftlichen Widersprüchen, sondern im Wesentlichen an drei Sachverhalten:
1. Am Machtkampf in der CSU: Für die Christsozialen ist Bundespolitik stets nur ein von Münchner Interessen abgeleitetes Spielfeld, dessen Wirkungen in bayerischer Innenpolitik abgerechnet werden. Während Seehofer deshalb mit den Sondierungen einerseits um sein politisches Überleben oder wenigstens sein politisches Erbe kämpfte, war die auf ihn folgende Generation damit befasst, Diadochenkämpfe auszufechten bzw. anzunehmen, dass jede Neuwahl nach Seehofer und im besten Falle nach Merkel die CSU nach vorn bringen könnte. Nur so erklärt sich die ohne jede Beweisführung auskommende Aussage des CSU-Fraktionsvorsitzenden im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, die Partei würde bei Neuwahlen gestärkt hervorgehen. Nach Angaben von Forsa in einer Umfrage für das RTL/n-tv-"Trendbarometer", die am 20.11.2017 bei 1.789 Wahlberechtigten durchgeführt wurde, wird diese Hoffnung nicht bestätigt. Die Union käme derzeit auf 31 Prozent. Aber 70 Prozent meinen, dass Horst Seehofer seine Ämter als CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident zur Verfügung stellen sollte. Von den CDU-Anhänger/-innen sprachen sich 73 Prozent, von den CSU-Wähler/-innen 64 Prozent dafür aus.
2. An der Furcht der FDP, in einer Koalition mit Union und Grünen wieder abzustürzen und wie 2013 abgewählt zu werden: Der Thüringer FDP-Landesvorsitzenden und nunmehr in den Bundestag gewählte Abgeordnete, Thomas Kemmerich, ließ sich bereits am Beginn der Sondierungsgespräche mit den Worten zitieren: "Um es im saloppen Politikjargon zu sagen: wer sich mit dieser Bundeskanzlerin ins Bett legt, kommt darin um". Die FDP feierte zwar bei der Bundestagswahl ein furioses Comeback, gleichwohl gehört zur kollektiven Erinnerung der Liberalen der schmachvolle Rauswurf aus dem Bundestag 2013. Zwar gaben 70 Prozent der befragten FDP-Wähler/-innen bei der Bundestagswahl 2017 gegenüber Infratest dimap an, dass das Votum für die Liberalen dazu dienen sollte, eine weitere Große Koalition zu verhindern, doch die 51 Prozent, die nach dem Ende der schwarz-gelben Koalition meinten, dass die Liberale Partei in Deutschland nicht mehr gebraucht werde, steckt der FDP noch in den Knochen. Die negative Bewertung der FDP 2013 war zudem kein singulärer Ausreißer, sondern zeichnete sich bereits länger ab. In den Augen der Wahlberechtigten versprach die Partei „seit Jahren mehr als sie hält“. Bereits im Januar 2012 stimmten 83% der von Infratest dimap befragten Deutschen dieser Aussage zu. Eine ebenso große Zahl hielt im Mai 2011 die FDP für wenig bzw. gar nicht glaubwürdig und im Januar 2011 kritisierten 72% der Befragten, dass die FDP vor allem Politik für bestimmte Wählergruppen mache, also das Allgemeinwohl vernachlässige. Kurzum: Das Dilemma der FDP bestand 2013 in der Entkopplung zwischen dem normativen Bild, das Bürgerinnen und Bürger von einer liberalen Partei zeichnen und der Sichtweise auf die FDP. Laut dem Institut für Demoskopie sahen vor vier Jahren zwar 27% der wahlberechtigten Bürger/-innen die Existenzberechtigung einer liberalen Partei, doch nur 19% eine Existenzberechtigung für die FDP. Die Annahme, die Wählerinnen und Wähler erwarteten von der FDP Opposition statt die Fähigkeit, eine Regierung zu stabilisieren, dürfte freilich wenigstens riskant eher sogar ein Irrtum sein. Es wird sich zeigen, ob goutiert wird, dass Lindner und Kubicki die Partei auf einen Tea-Party-Kurs zwingen, statt sich in die Tradition die Bundesrepublik prägender Liberaler wie Dahrendorf, Gerhard Baum oder auch Genscher zu stellen. Laut der zitierten Forsa-Umfrage vom 20.11.2017 hat mehr als die Hälfte der Bundesbürger (53 Prozent) kein Verständnis für die Entscheidung der FDP, die Sondierungen abzubrechen. 43 Prozent können das nachvollziehen. Rückendeckung für den Abbruch bekommt die FDP besonders von den Anhängern der AfD (80 Prozent) und von den eigenen Anhänger/-innen (64 Prozent).
3. Relevante Akteure in allen Parteien sehen in gescheiterten Jamaika-Gesprächen die Möglichkeit, früher als später die Post-Merkel-Ära einzuleiten: Damit sind zwei Ziele verbunden. Potentielle Koalitionspartner hoffen, eine als asymmetrisch empfundene Koalitionspolitik in der Merkel wahlweise als "Todesstern" oder "schwarze Witwe“ ihrer Koalitionspartner mythologisiert wurde, zu egalisieren. Innerhalb der Union geht es um nicht mehr und nicht weniger als die künftige Ausrichtung der Union, die im Spannungsfeld zwischen vermeintlicher „Entsozialdemokratisierung der CDU“, bei Bewahrung der Rolle als vermeintlich einzig verbliebener Volkspartei verläuft, hinreichend unscharf und dementsprechend offen ist. Klar ist, dass die Union ihre Strategie zu klären hat und die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen sie nun auch an der Person der Kanzlerin eröffnen werden - aus Sicht von Altmaier und Merkel der größte anzunehmende Unfall. Zudem besteht die Gefahr nicht allein in der Union, sondern für das Parteiensystem insgesamt, dass in der Union die Orientierung am österreichischen „Modell Kurz“ Raum greift. Diese Fokussierung auf Einzelpersonen, wie sie bei Forza Italia, der Bewegung Macrons u.a. zu besichtigen ist, unterwirft die Parteiorganisation - anders als im System Kohl oder Merkel - verderblich Personenkonjunkturen. Sie sind demokratiepolitisch fatal.
Aus den vorgenannten drei Gründen konnte Jamaika nicht erfolgreich sein. Auch nach wochenlangen Sondierungen hatten die vier Parteien keine tatsächlich zufriedenstellende Lösung anzubieten, die Spielraum für vier Jahre gemeinsamer Politik bietet. Die „atmende Obergrenze“ wäre ein CSU-Sargnagel grüner Glaubwürdigkeit und blau-weißer Politikfähigkeit gewesen.
Der nächste Schritt: Dritter Wahlgang für eine Minderheitsregierung
Nachdem in den vergangenen Wochen das Heft des Handelns in den Händen der vier verhandelnden Parteien lag, muss nun der Bundespräsident agieren. Der Kanzlerin steht die Möglichkeit, die Vertrauensfrage zu stellen, nicht mehr zur Verfügung, da die Bundesregierung nach Art. 69 Grundgesetz (GG) nur noch geschäftsführend im Amt ist.
Will Angela Merkel weiterhin agieren, muss sie sich im Bundestag zur Wahl stellen. Artikel 63 GG bestimmt, dass im ersten und zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit erforderlich ist. Wird diese im ersten Wahlgang nicht erreicht, kann binnen 14 Tagen ein zweiter Versuch unternommen werden. Wird das Quorum erneut nicht erreicht, ist ein dritter Wahlgang möglich, indem die einfache Mehrheit ausreichend ist.
Würde die Kanzlerin - wider Erwarten - mit absoluter Mehrheit gewählt, muss der Bundespräsident sie ernennen. Bei Wahl mit einfacher Mehrheit, kann er sie ernennen oder das Parlament auflösen. Frank-Walter Steinmeier hat am Wochenende in einem Interview deutlich gesagt, dass er in den politischen Verhältnissen keine Notwendigkeit für Neuwahlen erkennt. Dies würde für eine Ernennung von Frau Merkel sprechen, würde sie sich dieses Procederes unterziehen, was sicherlich davon abhängt, wie wahrscheinlich ihre Wahl und eine daraus logisch folgende Minderheitsregierung wäre, die die Union mit den Grünen bilden könnte. Einem solchen Bündnis fehlten freilich 42 Stimmen.
Nach Grunden setzen Minderheitsregierungen, wollen sie stabil handeln können, bestimmte Rahmenbedingungen voraus (Grunden 2011: 3f.):
1. Eine einigungsunfähige Opposition: Diese Bedingung ist gegeben, denn die programmatischen Differenzen zwischen SPD, AfD, FDP und LINKEN schließen die Einigung auf eine alternative Regierungsmehrheit ebenso aus, wie punktuelle Abstimmungen in bedeutenden Fragen, die das Minderheitenkabinett zwingen würde, eine gegen sie gerichtete Agenda ausführen zu müssen.
2. Eine Policy-Zentrierung des Parteienwettbewerbs: Auch diese Voraussetzung wäre erfüllt, da es CDU und Grünen durchaus gelingen könnte einzelne Parteien, naturgemäß SPD und FDP mit Kompromissen in Sachfragen zu überzeugen und dadurch Mehrheiten zu erzeugen.
3. Eine starke Kohäsion des Regierungslager: Dies würde voraussetzen, dass es in Minderheits-Koalitionsverhandlungen CSU und Grünen gelingt, miteinander stabile Vereinbarungen zu treffen. Den Machtkampf in Bayern gelöst - könnte dies nicht undenkbar sein.
Berlin ist nicht Weimar
Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Grundgesetzes sprechen für ein solches Modell. Die vom Parlamentarischen Rat in die Verfassung eingebauten Stabilisatoren sind eine Konsequenz der Erfahrungen aus Weimar.
Dennoch gibt es eine mit der Pfadabhängigkeit zu erklärende German Angst vor instabilen politischen Verhältnisse. Gerade in global unruhigen Zeiten einer zerklüfteten politischen Stimmung im eigenen Land sind sich relevante politische Akteure ebenso wie politische Analyst/-innen einig, dass diese Regierungsform Merkel und Deutschland schwach erscheinen lässt. Bereits am Abend der Bundestagswahl formulierte die Kanzlerin: "Ich habe die Absicht, dass wir zu einer stabilen Regierung in Deutschland kommen".
Diese Position muss man nicht teilen. Vielmehr kann dagegen dreierlei eingewandt werden:
1. Berlin ist nicht Weimar, obwohl die Berliner Republik in unruhigeren Zeiten als die Bonner Republik zu agieren hat. Das Parteiensystem ist vielfältiger geworden. Mehrparteien-Koalitionen sind nicht zwingend instabiler als klassische Zwei-Parteien-Bündnisse, wie an anderer Stelle auf diesem Blog bereits deutlich gemacht wurde.
2. Zudem stellt sich die Frage, ob nicht gerade Kanzlerin Merkel und ihrem politischen Personal das Kunststück gelingen könnte, Minderheitsregierungen vom Geruch des Versagens und den Assoziationen der späten Weimarer Republik zu befreien. Wesentliche Entscheidungen, wie z.B. Auslandseinsätze der Bundeswehr, europapolitische Maßnahmen aber auch gesellschaftspolitische Modernisierungen wurden gerade unter Kanzlerin Merkel stets mit dem Anspruch versehen, breite parlamentarische Mehrheiten zu finden. Sie hat den präsidentiellen Regierungsstil zu ihrer politischen Kunst gemacht.
3. Der bisherige Chefredakteur der Tageszeitung „Neues Deutschland“, Tom Strohschneider, hält in einer ersten Betrachtung der Lage nach den gescheiterten Sondierungen als Ausgangslage, die zu neuen politischen Pfaden führen muss fest: „Es geht (...) unter anderem auch darum, das doppelte Auseinanderdriften von politischer Form und politischem Inhalt in den Blick zu nehmen – weder passen a) die auf das Nationalstaatliche begrenzten politischen Regelungen noch mit der globalen Realität der Ökonomie zusammen (siehe Debatten über Europa, Ungleichheit, Besteuerung oder Freihandel), noch bilden b) die politischen Parteien hierzulande wie noch in der Vergangenheit einigermaßen kohärente Lager ab – die Risse, die heute innerhalb der Parteien verlaufen, sind oft tiefer als diejenigen zwischen ihnen.“
Wirkung auf SPD und LINKE - kein Fenster für Mitte-Links
Die SPD würde in einer solchen Konstellation stets als Partner zur Verfügung stehen. Aus den gleichen Gründen wie sie bislang in einer Großen Koalition regierte: Staatspolitische Verantwortung in der Opposition und die Hoffnung, aus der Oppositionsbewegung heraus, zur Kanzler/-in-Partei zurückzukehren. Innenpolitisch würde sie dies abbilden sowohl durch ihre Vertreter/-innen in der bunter gewordenen Ministerpräsidentenkonferenz und auch über den Bundesrat. Strategisch selbst im Dilemma mit einem Parteivorsitzenden, der keine Alternative mehr für Neuwahlen wäre und in einer Selbstbeschäftigung bei der nicht klar ist, ob sie als von vielen Mitgliedern und gewünschte Erneuerung der Partei trägt, würde ihr im besten Falle die Gelegenheit eines klaren oppositionellen Gestaltungsvorteils gegenüber der Linkspartei aber auch der desavouierten FDP in den Schoß fallen. Eine Tolerierung von schwarz-grün ist FDP-seitig nicht zu erwarten.
DIE LINKE hätte in einer solchen Konstellation noch ärgere Probleme, sich gegen SPD und AfD strategisch und inhaltlich zu behaupten. Die Aussage des Parteivorsitzenden Bernd Riexinger „Wir scheuen Neuwahlen nicht. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Aber Neuwahlen machen vor allem dann Sinn, wenn es eine klare Alternative zu Merkel gibt. Darin besteht auch eine Chance.“ relativiert sich dadurch deutlich. Für DIE LINKE würde sich freilich die Notwendigkeit und gleichzeitige Chance verstärken, ihre offenen inhaltlichen und strategischen Fragen tatsächlich zu klären. Sie könnte auf diesem Wege ihren Beitrag für die Neueröffnung eines rot-rot-grünen Window of Opportunity leisten, statt in der Sackgasse Personalquerelen auszuboxen, was für die politischen Verhältnisse und den eigenen Gestaltungsanspruch so wirkungsvoll wie Schattenboxen ist.
Nachtrag zur Forsa-Umfrage vom 20.11.2017, 19 Uhr:
In einer Forsa-Umfrage für das RTL/n-tv-«Trendbarometer» sprachen sich 45 Prozent der Wahlberechtigten für erneute Wahlen aus, wie die Mediengruppe RTL am Montag mitteilte. 27 Prozent hätten gern wieder eine große Koalition, 24 Prozent sind für eine Minderheitsregierung. Käme es jetzt zu Neuwahlen, würden sich die Deutschen aber kaum anders entscheiden als bei der Bundestagswahl vor zwei Monaten. CDU/CSU kämen laut Forsa auf 31 Prozent (bei der Wahl: 33), die SPD würde 21 Prozent schaffen (20,5), die FDP 10 Prozent (10,7) und die Grünen 12 Prozent (8,9). Die Linke käme auf 9 Prozent (9,2) und die AfD auf 12 Prozent (12,6).
Forsa hat am 20. November 1789 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt plus/minus 2,5 Prozentpunkte