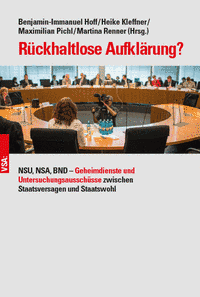#SPD-Neoliberalismus vs. #LinkeHeuchler
Beitrag auf dem Blog von www.freitag.de vom 3. Juni 2017
Es ist Freitagnachmittag der 2. Juni 2017. Vor 50 Jahren wurde Benno Ohnesorg erschossen. Die sich auch daraus entwickelte 68er Bewegung brachte u.a. die Partei Die Grünen hervor, hatte wesentlichen Einfluss auf die SPD, die ab 1969 erstmals in der Großen Koalition regierte und prägte auch einen relevanten Teil der Anhänger/-innen der heutigen Linkspartei.
Einmal im Monat tagt an der Leipziger Straße in Berlin der Bundesrat. So auch an diesem Freitag. Der Bundestag liegt in Sichtweite. Am Vortag passierten im Bundestag - gegen die Stimmen der anwesenden 54 MdB der Linksfraktion, 29 Mitgliedern der SPD-Fraktion und 2 Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen - die Änderungen des Grundgesetzes zur Föderalismusreform das Parlamentsplenum. Sie sind Teil eines großen Gesetzespaketes, zu dem u.a. auch die Änderung des Unterhaltsvorschusses sowie Regelungen zur Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft gehören. Letztere sind umstritten. Es geht um die Frage, ob dadurch Privatisierungen über den Weg öffentlich-privater Partnerschaften geebnet werden.
Da twittert der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag, Thomas Oppermann:
"Linke Fenster-Rede von @SWagenknecht in BT aber im BR stimmen alle Länder, in denen die Linke mitregiert, für das Gesetz. Linke #Heuchler"
Nur einen Tag später erklärt die Fraktionsvorsitzende der LINKE im Deutschen Bundestag, Sahra Wagenknecht, in einem Interview gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag - das offenbar bereits ein bis zwei Tage vorab gegeben wurde:
"Es sieht so als sei rot-rot-grün tot."
Beide Aussagen sind ein weiterer deprimierender Tiefpunkt im traditionell pathologisch gestörten Verhältnis zwischen SPD und Linkspartei. Und es ist ein Desaster für Mitte-Links, das alle diejenigen wütend machen muss, die seit Jahren darum kämpfen, vom Politikwechsel nicht nur voluntaristisch zu schwadronieren, sondern ihn ernsthaft zu betreiben.
Um zu verstehen, worum es beim Oppermann-Tweet und dem Wagenknecht-Interview geht, müssen drei Ebenen von einerander getrennt werden:
- Die Kontroverse über das Ziel des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble, durch die Bildung einer Bundesfernstraßengesellschaft privaten Investoren neue Anlagemöglichkeiten in Form von Privatisierungen oder öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) zu ermöglichen.
- Die instrumentelle Debatte um das Abstimmungsverhalten der Länder zu den Bund-Länder-Finanzen im Bundesrat, die weit über die tagespolitische Auseinandersetzung hinausgeht und zwischen SPD und Linkspartei sowie innerhalb der beiden Parteien ausgetragen wird. Hier geht es um Abgrenzungsrituale zwischen den Parteien und grundsätzliche Kritik an Gestaltungspolitik aus prinzipieller Oppositions-Orientierung, die eine ironische Hochzeit mit Akteuren der SPD-Rechten eingeht.
- Der Lernprozess innerhalb der Partei DIE LINKE, die mit der Wahl des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in das konsensorientierte System föderaler Entscheidungsprozesse, bestehend aus Ministerpräsidentenkonferenz, Vermittlungsausschuss etc. eingebunden ist und innerhalb der Linkspartei traditionelle Vorbehalte gegenüber Gestaltungspolitik in Regierungen aktiviert.
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen
Abgestimmt wurde am 1. Juni 2017 im Bundestag und am 2. Juni 2017 im Bundesrat über die Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, also das System nachdem das Geld zwischen Ländern und dem Bund verteilt wird. Der bisherige Länderfinanzausgleich musste neu gefasst werden, da er zum Jahresende 2019 ausläuft.
Darüber, wie die Mittel im Länderfinanzausgleich verteilt werden, gibt es seit Jahrzehnten intensive Diskussionen und viel Streit, der nicht zuletzt mehrfach vor dem Bundesverfassungsgericht ausgefochten wurde. Denn dass zwischen Stadtstaaten (Hamburg, Berlin und Bremen) und Flächenländern, Ost- und Westdeutschland, hochverschuldeten kleinen Nehmerländern (z.B. Saarland, Bremen) sowie finanzstarken Geberländern (u.a. Bayern, Baden-Württemberg) die Interessen weit auseinander gehen, liegt auf der Hand. Gemeinhin gelang es der jeweiligen Bundesregierung die Länder untereinander auszuspielen und auf diesem Wege einen für den Bund passablen Lösungsweg zu finden.
Bei dieser Verhandlungsrunde hatten sich jedoch - trotz veritabler Differenzen zwischen NRW und Bayern auf der einen Seite sowie z.B. den Ost-Ländern auf der anderen Seite - die Ministerpräsident/-innen der Länder entschieden, bis zum Ende mit einer Stimme zu sprechen und sich nicht auseinander dividieren zu lassen.
Diese für den Bund nicht neue aber doch überraschende Entwicklung führte dazu, dass die Länder den Bund dazu zwangen, ab dem Jahr 2020 jährlich 9,75 Milliarden Euro an die Länder zu überweisen. Dazu war er anfangs überhaupt nicht und nach monatelangen Verhandlungen nur gegen Zugeständnisse bereit.
Bundesfinanzminister Schäuble hatte dazu eine lange Liste von Forderungen aufgestellt. Dazu gehörte unter anderen eine „Regionalisierung der Sozialgesetzgebung“. Das heißt, die Länder sollten bei der Art und dem Umfang von Sozialleistungen von den geltenden Sätzen abweichen können. Diese und weitere Forderungen wurden von den Ländern mehrheitlich abgelehnt und konnten abgewehrt werden, auch mit Unterstützung von Landesregierungen mit LINKE-Beteiligung.
16 Länder geschlossen gegen "divide et impera" des Bundes - und dennoch erpressbar
Gleichwohl mussten die Länder auch gemeinsam Kröten schlucken, denn sie sind durch den Bund strukturell erpressbar. Dem Bund ist es in den vergangenen Jahren im Rahmen seiner Finanzpolitik gelungen, die Länder in eine finanzielle Abhängigkeit zu bringen. Diese Asymmetrie im Handlungsspielraum nutzte der Bund gezielt bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen, um die 9,7 Mrd. EUR-Zahlungen, zu denen die einheitliche Länderfront ihn gezwungen hatte, mit einem Kopplungsgeschäft zu verbinden. Auf diesem Wege wollte er eigene andere Ideen, die sonst keine Chance auf Durchsetzung gehabt hätten, durchdrücken. Das Problem: Wichtige Gesetzesgrundlagen des noch geltenden Finanzausgleichssystems sind bloß bis zum 31.12.2019 befristet.
Wäre nichtrechtzeitig vorher eine Einigung gefunden worden, hätten vor allem die finanzschwächeren Länder in ihren Haushalten - trotz positiver Steuerentwicklung - in relevantem Maße Ausgaben streichen müssen. Nachstehende Zahlen verdeutlichen die Relevanz der Bund-Länder-Finanzen für die drei von der Linkspartei mitregierten Länder:
- Für Brandenburg geht es bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen um Beträge von mindestens 780 Mio. EUR jährlich.
- Für Thüringen sind es mindestens 845 Mio. EUR pro Jahr.
- Für Berlin 460 Mio. EUR jährlich.
- Weitere 1,8 Mrd. EUR für Brandenburg sowie 2,2 Mrd. EUR für Thüringen und rund 3,5 Mrd. EUR für Berlin wären in erheblichem Umfang mit Risiken behaftet gewesen.
Hätte es bis zum Ende der Wahlperiode im September (bzw. bis zum Ende der Sitzungswochen des Bundestages Anfang Juli) keinen Beschluss zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen gegeben, hätte diese Neuordnung mit der kommenden Bundesregierung komplett neu verhandelt werden müssen.
Die nun beendeten Hauptverhandlungen dauerten rund drei Jahre. Wären bei potenziellen Neuverhandlungen bis Jahresende 2019 kein Ergebnis, wären die Gelder aus dem Finanzausgleich ab 2020 für Brandenburg, Thüringen und Berlin mit unkalkulierbaren Risiken behaftet gewesen, denn dann läuft der bisherige Länder-Finanzausgleich aus. Lediglich die Finanzverfassung des Grundgesetzes hätte danach noch gegolten. Dort ist zwar ein Finanzausgleich allgemein festgeschrieben. Unklar ist dabei jedoch die konkrete Höhe der Mittel für die Länder. Mit dem Auslaufen des so genannten Maßstäbegesetzes und des Finanzausgleichgesetzes Ende 2019 wären die Einnahmen aus dem Vorwegsausgleich der Umsatzsteuer und dem so genannten horizontalen Länderfinanzausgleich ungewiss gewesen.
Des Weiteren hätte ab 2020 kein Anspruch auf die sogenannten Bundesergänzungszuweisungen, sowie auf die jetzt für 2020 insgesamt prognostizierten Mehreinnahmen aufgrund der Umstellung auf den neuen Finanzausgleich, bestanden. Diese Mittel hätten auf dem Klageweg (ggf. im Eilverfahren) geltend gemacht werden müssen. Ein derartiges Vorgehen wäre besonders für die finanzschwachen Länder mit erheblichen Risiken verbunden gewesen. Darunter würden mithin auch die Kommunen leiden, denn das Land könnte weniger Geld über den kommunalen Finanzausgleich ausschütten.
Unklar ist zudem, ob eine Neuverhandlung den Ländern nicht Nachteile brächte. Denn im Grunde ist die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen für die Länder sehr erfolgreich verlaufen. Ob man bei Neuverhandlungen mit dem Bund ein solches Ergebnis noch einmal erreicht hätte, kann getrost ausgeschlossen werden.
Dazu kommt: Wenn sich die Union im Herbst in einer schwarz-gelben Bundesregierung mit ihren Steuererleichterungsplänen durchsetzen würde, müssten Bund und Länder gemeinsam mit 15 Mrd. € Mindereinnahmen rechnen. Das würde für die Länder bedeuten, dass die gewährten Zuschüsse aus dem Länderfinanzausgleich durch eine Schäublesche Steuerreform so gut wie aufgefressen wären. Die Risiken für die Länderfinanzen wären durch ein Scheitern des Finanzausgleichs also im Zweifel verdoppelt worden.
Die Länder waren also tatsächlich erpressbar, weil sie durch einheitliches Agieren dem Bund milliardenschwere Mehrausgaben abgetrotzt hatten. Die Länder erhalten durch die neuen Regelungen erstmals langfristige Sicherheit, mit welchen Bundesmitteln sie mindestens rechnen können. Sie können so eigenständiger und nachhaltiger ihre Haushalte planen. Ein von rot-grünen, rot-roten oder R2G-Ländern erzwungenes Scheitern des Finanzausgleichs durch Ablehnung im Bundesrat hätte auch die Länder, in denen DIE LINKE regiert, um die Möglichkeit gebracht, dringend notwendige und von ihr in die Koalitionsverträge hineingekämpfte Investitionen im sozialen Bereich, in die Infrastruktur, in Jugend und Bildung umzusetzen.
Die neue Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes und Interessenpolitik für Shareholder Value
Mit dem Bund-Länder-Finanzpaket wurde aber auch eine Menge anderer Fragen geregelt, von Investitionen in die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen über den Unterhaltsvorschuss, einen verbindlichen bundesweiten Online-Portalverbund für digitale öffentliche Dienstleistungen für die Bürger/-innen, bis hin zur Gründung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes.
Letztere stand bisher am meisten im öffentlichen Fokus. Der Bund erhält dabei die alleinige Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen.
Gegenstand der Kritik ist nicht die Übertragung der Autobahnverwaltung an den Bund. Dafür sprechen durchaus gute Gründe eines sehr uneiheitlichen Umgangs der Länder mit entsprechenden Investitionsvorhaben sowie Einsparungen der Länder in den Straßenbauverwaltungen.
Problematisch ist vielmehr, dass damit Privatisierungen von Autobahnen und anderen Gütern der Daseinsvorsorge die Tür geöffnet werden soll. Dagegen hatte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) bereits in der gemeinsamen Besprechung von Bundesregierung und den Ministerpräsident/-innen der Länder interveniert. Mit einer Protokollerklärung machte er für den Freistaat Thüringen deutlich, dass es eine Privatisierung der Infrastrukturgesellschaft, von Tochterunternehmen dieser Gesellschaft oder der Autobahn bzw. Teile an ihnen nicht geben darf. Er war der Einzige, der die Forderung nach einer Privatisierungsschranke erhob. Erst danach gingen weitere SPD-Ministerpräsident/-innen auf dieses Thema ein.
Dass die Infrastrukturgesellschaft des Bundes in der Rechtsform einer GmbH gegründet wird, sehen einige bereits als eine formelle Privatisierung an. Es gibt gute Argumente mit denen eingewendet werden kann, dass nicht die Rechtsform für die Privatisierung entscheidend ist, sondern der öffentliche Einfluss auf die Gesellschaft. Sie bleibt im vollen Besitz des Bundes.
Gleichwohl war es dem Bundesfinanzministerium wichtig, immer wieder die Tür für Privatisierungsoptionen zu öffnen. So bleiben Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) im Umfang von bis zu 100 km zulässig, nur größere ÖPPs werden ausgeschlossen. Hierdurch können private Investoren hohe Renditen aus dem Bau und Betrieb von Autobahnteilstrecken ziehen (Möglichkeit der funktionalen Privatisierung).
Diese Haltung setzte Schäuble in der Bundesregierung durch, trotz öffentlichen Stellungnahmen, Gutachten und Schreiben an die Bundeskanzlerin, in denen darauf verwiesen wurde, dass die vorgesehenen Privatisierungsbremsen für unzureichend gehalten werden, sowie kritischen Stellungnahmen in den zuständigen Fachausschüssen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates. Das rot-rot regierte Land Brandenburg hatte im Januar 2017 eine wirksame, grundgesetzliche Privatisierungsschranke und eine Begrenzung von ÖPP-Möglichkeiten gefordert. Dies fand jedoch keine Mehrheit im Bundesrat. Zuletzt haben der Thüringer Ministerpräsident, Bodo Ramelow, Brandenburgs Finanzminister und Vize-Regierungschef, Christian Görke, sowie der Berliner Kultursenator und Bürgermeister, Klaus Lederer, als LINKE in Landesregierungen nochmal den Bundestag aufgefordert, hier wirksame Privatisierungshindernisse zu vereinbaren.
Nach diesem erheblichem Druck von der LINKEN in Partei, Fraktionen und Landesregierungen hat sich die Große Koalition auf Änderungen verständigt, die jedoch weiterhin Hintertüren offen lassen. Daran hat die Linksfraktion im Deutschen Bundestag und haben die drei von den LINKEN mitregierten Länder mit einem Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses sowie das Land Niedersachsen mit einer Protokollerklärung im Bundesrat am 2. Juni Kritik geübt.
Im Vermittlungsausschuss strebten die drei von den LINKEN mitregierten Länder folgende Änderungen an:
- Das Verbot der Kreditaufnahme durch die Infrastrukturgesellschaft sollte ins Grundgesetz geschrieben werden. Denn dies ist zwar schon vorgesehen, aber nur in einem Begleitgesetz geregelt. Die Gefahr besteht, dass ein solches Gesetz von einer neuen Bundesregierung mit einfacher Mehrheit dann verändert wird. Eine Festschreibung im Grundgesetz ließe sich auch in Zukunft nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ändern.
- Ein gänzlicher Ausschluss von ÖPP bei Autobahnprojekten im Grundgesetz ist notwendig. Dabei muss man jedoch beachten, dass es bereits jetzt ÖPPs gibt (60 km auf der A7, 47 km auf der A6, 33 km auf der A94,...). Das heißt, es sollte - unabhängig von der jetzt bereits bestehenden ÖPP-Option - die Ausweitung in der Zukunft ausgeschlossen werden.
Wie zu erwarten war, fand eine solch grundsätzliche Ablehnung der Autobahnprivatisierung im Bundesrat keine Mehrheit. Der Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses wurde abgelehnt. Da es bei dem Paket um die Bund-Länder-Finanzen und um die Autobahn-Gesellschaft ging, haben nach einer harten Abwägung die linksregierten Länder - da es keine Option auf Abtrennung der Entscheidungssachverhalte gab, dem Gesamtpaket - mit Rücksicht auf die Finanzinteressen und die Koalitionspartner zugestimmt.
Ohne den Einsatz der Linkspartei auf den unterschiedlichen Ebenen sowie engagierte Sozialdemokrat/-innen im Bundestag, die eine gleiche Position wie die Linkspartei vertraten, wurden nicht unerhebliche Fortschritte erzielt. Das erstrebte Ziel wurde freilich nicht erreicht. Bitter und dennoch ein normaler Zustand innerhalb pluraler Entscheidungsfindung.
Der kurze Traum einer Normalisierung des Verhältnisses von SPD und Linkspartei im Schulz-Hype
In Auswertung der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl 2013 nahm die SPD auf dem Leipziger Parteitag endgültig Abstand davon, eine Regierung mit der Partei DIE LINKE auszuschließen. Das war überfällig und vernünftig. Genützt hatte diese Abgrenzung nur der Union, die in den Parteizentralen von CDU und CSU bisher sicher sein konnten, dass schon die Drohung einer Rote-Socken-Kampagne die SPD von einem Blinken nach links abhalten würde.
Geändert hatte sich dennoch auch nach dem Leipziger Parteitag nicht viel. Beide Seiten, sowohl DIE LINKE als auch die SPD pflegten ihr pathologisches Verhältnis weiter wie eh und je. Während DIE LINKE auf Bundesebene die SPD als Hauptgegner in der politischen Auseinandersetzung sah und entsprechend behandelte, zieh die SPD die Linkspartei als realitäts- und politikfern.
In der Bundestagsdebatte über die Änderung des Grundgesetzes zum Paket der Bund-Länder-Finanzen ließ sich dies am Donnerstag in besonderer Weise beobachten. Der Schlagabtausch zwischen Sahra Wagenknecht und Thomas Oppermann ließ im Ergebnis nur einen Schluss zu: Zwischen SPD und der Partei DIE LINKE besteht ein ausschließlich taktisch-instrumentelles Verhältnis zu rot-rot-grüner Zusammenarbeit ob auf Landes- oder Bundesebene. Es dominieren weiterhin massive Ablehnung und Vorwürfe, bei denen es unerheblich zu sein scheint, ob dies eine nachhaltige Unterminierung bis zur dauerhaften Schädigung der Perspektive eines Politikwechsels auf Bundesebene zur Folge hat.
Ein Irrsinn - insbesondere wenn wir nur einige Wochen zurückschauen. Nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat und erlebte die SPD einen Hype, von dem die Partei nicht nur selbst überrascht, sondern regelrecht euphorisiert wurde. Auf einmal schien alles möglich - mit der Union auf Augenhöhe in den Meinungsumfragen, nach 19 Jahren erneut ein Kanzlerwechsel zugunsten der SPD, sogar ein rot-rot-grünes Bündnis rückte in den Bereich des Realistischen.
Der Bundestagswahlkampf, von dem viele politische Beobachter/-innen befürchteten, er würde eine genauso schleppende Partie wie 2013 sein, an deren Ende die vierte Amtszeit der Kanzlerin stünde, kam in Fahrt.
Auf einmal gab es Optionen und Alternativen - rot-rot-grün oder Ampel unter SPD-Führung gegen eine CDU-geführte Jamaika-Koalition. Die AfD verlor an Öffentlichkeit, da nicht mehr auf ihrem Tanzfeld nach deren Musik gespielt wurde. Mit dem Ergebnis absinkender Zustimmungswerte in den Meinungsumfragen.
Wie in einem Beitrag zur Saarland-Wahl auf diesem Blog gezeigt wurde, konnte Martin Schulz bei der Landtagswahl im Saarland tatsächlich eine spürbare Mobilisierungswirkung erzielen. Drei Aspekte sprachen dafür:
- 1. Laut Forschungsgruppe Wahlen stimmten 80% der Aussage zu, dass für das Abschneiden der SPD im Saarland Martin Schulz eher hilfreich sei. Für das Abschneiden der CDU im Saarland hielten nur 31% die Kanzlerin für hilfreich, während rund ein Viertel (26%) meinten, dies würde eher schaden. Laut Infratest dimap gaben 66% der CDU-Wähler/-innen im Saarland an, dass die Kanzlerin ein wichtiger Grund gewesen sei, die CDU zu wählen, aber 79% der SPD-Wähler/-innen sagten dies über Martin Schulz.
- 2. Gefragt von Infratest dimap, wer für notwendige Veränderungen sorge, zeigen sich 62% der Befragten überzeugt, dass dies Martin Schulz sei, den 67% für bürgernäher halten als Frau Merkel (17%). Sechs Prozentpunkte trennt beide bei der Glaubwürdigkeit (43% Merkel vs. 37% Schulz).
- Während 76% der von Infratest dimap Befragten der Auffassung sind, dass Martin Schulz "frischen Wind in die Politik bringt", meinen 63%, dass Frau Merkel "ihre besten Zeiten als Bundeskanzlerin hinter sich" habe. Weitere 64% glauben, dass mit Schulz wieder sichtbare Unterschiede zwischen SPD und CDU bestünden.
Innerhalb der SPD wurde diese Landtagswahl jedoch als Niederlage interpretiert und dem Kanzlerkandidaten zugeschoben. Ohne Not wurde durch die SPD ein Narrativ aus dem Konrad-Adenauer-Haus- das hier auf diesem Blog bereits beschrieben wurde - übernommen. Es wurde zur wesentlichen Erzählung und strategischen Ausrichtung in den Wahlkampfendspurts von Schleswig-Holstein und NRW entfaltete. Die Geschichte lautet grob, dass die Aussicht auf eine Regierung ohne Union die Unionswähler mobilisiert und die Aussicht auf eine Regierung mit der LINKEN die SPD-Anhänger demobilisiert. Für beide Teile dieser Geschichte gibt es keinerlei belastbare demoskopische Belege, aber sie ist inzwischen so oft aus beiden großen Parteien erzählt und - wichtiger noch - als Voraussetzung für die eigene politische Kommunikation akzeptiert worden, dass sie in der medialen Berichterstattung den Status einer nicht weiter zu hinterfragenden Wahrheit erhalten hat.
So nimmt es nicht wunder, dass Rot-Rot-Grün von der Option auf Bewegung im Parteienwettbewerb und eine von mehreren Mitte-Links-Optionen zum altbekannten Wähler/innenschreck mutierte, zu dem R2G seit jeher überhöht wird. Im Lichte dessen traf die SPD die folgenschwere Entscheidung, bei den auf die Saarland-Wahl folgenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen auf die Unterstützung des Kanzlerkandidaten zu verzichten.
Was einer Doppelstrategie entsprang, die sicher geglaubten Erfolge bei den Landtagswahlen nicht durch einen möglicherweise enttäuschenden Kanzlerkandidaten zu beschweren und ihn bei unwahrscheinlichen aber dennoch möglichen Niederlagen nicht zu beschädigen, erwies sich als schwerer Fehler. Die SPD steht heute - wenige Wochen vor der Bundestagswahl - mit leeren Händen da:
- Zwei Ministerpräsidenten verloren - erstmals seit 12 Jahren,
- ein Kanzlerkandidat, der furios startete und dem nun ein Sieg nicht mehr zugetraut wird,
- politische Konstellationen wie die Ampel oder rot-rot-grün spielen in der politischen Öffentlichkeit keine Rolle mehr - damit fehlt der SPD jede glaubwürdige Option, die Kanzlerin abzulösen.
Die Parteien fallen angesichts dessen in ihre alten Rollen zurück. Für das Verhältnis von SPD und Linkspartei, die einige angenehme Monate bereit waren, miteinander über gemeinsame Gestaltungspolitik ernsthaft und jenseits der kleinen Zirkel wie Oslo-Gruppe oder dem Institut Solidarische Moderne zu sprechen, bedeutet dies den Rückfall in langjährig vollzogene pathologische Abgrenzungs- und Delegitimierungsrituale.
Pathologische Rituale zwischen SPD und Linkspartei und Sektkorken bei der Union
Der stellvertretende Parteivorsitzende Ralf Stegner nannte am Tag der Landtagswahl in Schleswig-Holstein den verpassten Einzug der LINKEN in den Landtag einen Erfolg, ohne auf den Einzug der rechten AfD einzugehen. Die Strategie der NRW-SPD, die darauf abgezielt hatte, DIE LINKE aus dem Landtag herauszuhalten, obwohl in Kiel wie in Düsseldorf der Einzug der Partei in den Landtag die Regierungsübernahme der CDU in beiden Ländern hätte verhindern können, erwies sich als Fehler. DIE LINKE, die mit rund 8.500 Stimmen am Einzug in den Landtag scheiterte, hätte die Sperrwirkung für das schwarz-gelbe Bündnis an Rhein und Ruhr sein können, das nunmehr in den Koalitionsverhandlungen ankündigte, rot-grüne Reformen zurückzunehmen: die Abschaffung der Studiengebühren und die Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres. Ohne DIE LINKE im Landtag und mit einer SPD in der Opposition werden Familien und Studierende belastet.
Aber auch DIE LINKE hält es nicht besser. Die SPD, nicht die Politik der Kanzlerin und der Union wird - entgegen oder zumindest unabhängig von der eigentlichen Wahlstrategie - erneut zum Hauptgegner im Bundestagswahlkampf erklärt.
Selbst wenn historische Vergleiche bekanntermaßen hinken, ist ein gewisses Muster dieser linken Umgangsweise mit der SPD schon aus den 1920er Jahren von der KPD bekannt. Mit den Wechseln von Levy/Brandler zu Fischer/Maslow schwankte die Partei in steter Folge zwischen dem Ruf nach der Einheitsfront und dem Sozialfaschismus-Vorwurf gegenüber der SPD und innerhalb des ADGB. So wurden Bündnisoptionen zerrieben. Diese Pfadabhängigkeit scheint auch über 100 Jahre nach der Spaltung der Arbeiter/-innenbewegung Bestand im politischen Unterbewusstsein zu haben. Profiteure dessen sind allein die Konservativen und der rechts davon bestehende Block.
Weder die SPD, noch DIE LINKE und Die Grünen haben das Ergebnis der Bundestagswahl 2013 als "letzte Warnung" ausreichend verstanden. Alle drei Parteien haben derzeit noch im Bundestag nur deshalb eine rechnerische Mehrheit - die derzeit wieder in weite Ferne gerückt ist - weil FDP und AfD den Einzug in den Bundestag 2013 verpasst hatten. Bei dieser Wahl - und trotz rot-grüner Wahlsiege bei Landtagswahlen - offenbarte sich statt dessen ein massiver Rechtsruck.
Keine der drei Parteien hat die seitdem vergangenen knapp 4 Jahre trotz vieler Ansätze wirklich ernsthaft genutzt, um das Ergebnis für die jeweilige innerparteiliche Strategiebildung zu verarbeiten. Die SPD geht so aussichtslos auf die Zielgerade wie 2013. Die Grünen sind so offen und damit allseitig angreifbar wie damals. DIE LINKE ist auf eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene fachlich und strategisch so wenig vorbereitet wie vor vier Jahren.
Verloren waren diese Jahre - zumindest bislang - nur deshalb nicht, weil sich die drei Parteien in drei Ländern eine Perspektive der Zusammenarbeit in jeweils verschiedenen Rollen erarbeitet haben, auf der man aufbauen könnte.
Auf Bundesebene stehen unter den gegebenen Bedingungen als Regierungskonstellationen im Herbst 2017 nur noch eine dritte GroKo, eine Neuauflage von Schwarz-Gelb oder ein Jamaika-Experiment zur Verfügung.
Landesregierungen in Berlin, Brandenburg und Berlin als instrumenteller Spielball im Abgrenzungsritual von SPD und Linkspartei
So gegensätzlich SPD und Linkspartei derzeit miteinander umgehen, treffen sie sich in ihrer pathologischen Umgangsweise dort, wo die Landesregierungen, in denen SPD und LINKE sowohl mit oder ohne Bündnis 90/Die Grünen regieren, zum jeweils instrumentalisierten Objekt werden.
Die SPD - dies war am Donnerstag dem 1. Juni 2017 in der Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann während der Debatte um die Grundgesetzänderungen zu besichtigen - versucht, gemäß eines Strategiepapiers aus dem Willy-Brandt-Haus, das dem Vernehmen nach entstanden sein soll, den Zankapfel zwischen Linkspartei, Linksfraktion und den linken Landesregierungen zu werfen. Letztere sollen als realpolitischen Alles-Mitmacher von Bundespartei und Bundestagsfraktion entfremdet werden. Dafür werden Bundestagsabstimmungen so ausgestaltet, dass in erpresserischer Form Sachverhalte bei den Grundgesetzänderungen gekoppelt wurden, die hätten getrennt voneinander abgestimmt werden müssen und können: die Bund-Länder-Finanzen mit weiteren Regelungen zu den föderalen Beziehungen einerseits und die Entscheidung über die Bundesfernstraßengesellschaft andererseits.
Bei einem Teil der Linkspartei, insbesondere dem Flügel, der die Linksregierungen stets wenn überhaupt nur tolerierte, weil er sie von jeher mit Misstrauen und Ablehnung begleitete, besteht für dieses Herangehen ironischerweise starke Resonanz.
Thomas Oppermann, Johannes Kahrs und Ralf Stegner - sonst als Speerspitze der Unglaubwürdigkeit in der SPD gebrandmarkt - werden auf einmal zu Kronzeugen von Vorwürfen gegenüber den Linksregierungen in den Ländern.
Daran ändert nichts, dass in der Bundesratssitzung am 2. Juni 2017 neben den Grundgesetzänderungen auf der Tagesordnung Themen standen, die zu wichtigen Forderungen der Linkspartei gehören und ohne die Linksregierungen in der zweiten Kammer des deutschen Parlamentarismus nie auf die Tagesordnung kommen würden oder bei denen die drei Länder wichtige Unterstützer sind, ohne die es zu solchen Anträgen wohl nicht käme, wie z.B.:
- TOP 21: "Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung der Folgen bei Zahlungsverzug im Wohnungsmietrecht",
- TOP 22 "Entschließung zur Stärkung der Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung durch erste Schritte in Richtung einer Bürgerversicherung"
- TOP 23: "Entschließung des Bundesrates zur Aufhebung des Transsexuellengesetzes sowie zur Erarbeitung eines Gesetzes zur Anerkennung der Geschlechtsidentität und zum Schutz der Selbstbestimmung bei der Geschlechterzuordnung".
Zu erwarten ist, dass sich an dieser Konstellation wohl selbst dann wenig ändern dürfte, wenn Jeremy Corbyn die Labour-Party aus einer vergleichsweise deprimierenden sozialdemokratischen Ausgangslage zum Sieg bei den britischen Parlamentswahlen führen dürfte.
Woran - bei aller Bedeutung der Bundestagswahl - jedoch niemand in SPD, Linkspartei und Grünen ein Interesse haben sollte, ist die Unterminierung der Zusammenarbeit von allen drei Parteien in den entsprechenden Landesregierungen Berlins, Brandenburgs und Thüringens.
Egal wie die Bundestagswahl ausgeht - die drei Länder sind Ausdruck der Fähigkeit, miteinander zu arbeiten. Sie lassen politische Ziele der drei Parteien, also auch der Linkspartei, in den Ländern Realität werden.
Die Wahlstrategien der Parteien sollten deshalb die Länder nicht zum Gegenstand des Bundestagswahlkampfs machen - im Gegenteil, sollten sie diese Arenen sozial-ökologischer Politik unterstützen und wertschätzen. Nicht weniger als das ist erforderlich.
Dies bedeutet innerhalb der Linkspartei jedoch endlich den Lernprozess zu vollziehen hinsichtlich des Rollenhandelns in Regierungs- und Oppositionsverantwortung. Dieser Lernprozess vollzieht sich im Kern schon lange, beschleunigt aber seit der Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten, mit der DIE LINKE einen Platz am Tisch der 16 Länderregierungsschef/-innen erlangte.
Seitdem ist DIE LINKE partiell in das konsensorientierte System bundespolitischer Meinungsbildung eingebunden. Sie verhandelt nun auch auf höchster Ebene mit und kann dadurch Positionen durchsetzen, die bislang unerreichbar waren. Um den Preis, Verhandlungsergebnisse auch dann mitzutragen, wenn das Erreichte nicht das Gewollte ist. Und gleichzeitig das Profil der eigenen Partei zu schützen und wenn möglich zu stärken. Dass dies im solidarischen Miteinander und nach heftigen Diskussionen gelingen kann, hat die gemeinsame Erklärung der Partei- und Fraktionschefs sowie der führenden Regierungsvertreter/-innen aus den Ländern im Nachgang zur Bundesratssitzung am 2. Juni 2017 gezeigt.
Es zeigt, dass DIE LINKE auch in einer schwierigen Frage drei Monate vor der Bundestagswahl zusammen bleibt. Das mag weder den Strategen einer Rote-Socken-Kampagne gegen DIE LINKE seitens der SPD im Willy-Brandt-Haus gefallen, noch denjenigen Heckenschützen aus der Linkspartei, die stets mit Offenen Briefen an die Öffentlichkeit treten, wenn Gestaltungspolitik mit »Roten Haltelinien« kollidiert. Aber es ist ein Fakt. Immerhin. Dennoch nur ein kleiner und sehr bitterer Trost angesichts des Fortschrittes, der vor nur wenigen Wochen im Hinblick auf Rot-Rot-Grün erreichbar schien.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Alexander Fischer, Staatssekretär für Arbeit und Soziales in der rot-rot-grünen Landesregierung Berlins. Beide Autoren geben ausschließlich ihre persönliche Meinung wieder.