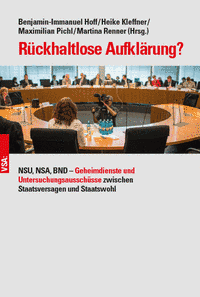Renaissance der Minderheitsregierung in NRW?!
Beitrag auf dem Blog von www.freitag.de vom 14. Mai 2017
Die Wahllokale in NRW sind geschlossen. Die rot-grüne Koalition hat übereinstimmenden ersten Hochrechnungen zufolge rund 13 Prozentpunkte gegenüber der Vorwahl eingebüßt. CDU und FDP gewinnen zusammen betrachtet mehr als 10 Prozent hinzu. Während die Piratenpartei auch aus dem letzten ihr verbliebenen Landtag herausfällt, zieht DIE LINKE aller Voraussicht mit knapp 5 Prozent nach fünfjähriger Abstinenz erneut in den Landtag in Düsseldorf ein, während die AfD mit 7,5 Prozent den nächsten Landtag erobert und das Parteienspektrum im Landtag auf ein neues Höchstmaß ansteigt.
NRW - die kleine Bundesrepublik
Landtagswahlen im bevölkerungsreichsten Land der Bundesrepublik Deutschland gelten vielfach als »kleine Bundestagswahlen«. Manchmal nimmt das Ergebnis bundespolitische Entwicklungen vorweg, genauer vielleicht: verhilft ihnen zum Durchbruch. So hatte die erste sozialliberale Koalition in der alten Bundesrepublik ihren Türöffner und Probelauf in Nordrhein-Westfalen.
Die »Herzkammer der Sozialdemokratie« (Katharina Barley) war das Land freilich nie, obwohl sich dieser Mythos des SPD-Stammlandes NRW hartnäckig hält, wie vom Autor in einem anderen Beitrag auf diesem Blog gezeigt wurde.
Wie vielleicht kein anderes Bundesland spiegelt sich in den Wahlergebnissen des Landes die politische Reaktion der Bürgerinnen und Bürger auf den langjährigen Strukturwandel, auf den Abbau der klassischen Schwerindustrie im Ruhrgebiet.
Das Ergebnis der Landtagswahl 2005 brachte einen Erdrutsch-Sieg der CDU (über 44%). Früher feste Parteibindungen lockerten sich, wachsende Teile der Wahlberechtigten wechselten zwischen CDU und SPD und/oder zwischen kleineren Parteien. Auf das Ergebnis 2005 reagierte die damalige SPD-Spitze Schröder-Müntefering mit der Herbeiführung vorgezogener Neuwahlen.
Buntes Umfragebild vor der Landtagswahl in NRW 2017
Die Umfragen zeichnen ein buntes Bild. Im Herbst 2013 und mehrfach danach lag die CDU mit der SPD in der Stimmung gleichauf, dies war auch zum Jahreswechsel 2016/17 der Fall. Erst nach der Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten schnellten die SPD-Werte nach oben, der Abstand zur CDU wuchs auf z.T. über zehn Prozentpunkte (»Schulz-Hoch«).
Nach Ostern lagen zumindest bei der Forschungsgruppe Wahlen und Infratest dimap beide Parteien gleichauf bei jeweils rund 32%. Mit dem Stimmungsaufschwung für die SPD sanken die Werte für den Koalitionspartner, gleichzeitig wurde DIE LINKE in den Umfragen konstant mit rund 6% bewertet, also wieder im Landtag gesehen. Ein Umfragehoch erlebte in den letzten Wochen vor der Wahl die FDP. Parallel sanken die Bewertungen für die AfD.
Insgesamt zeigen die Umfragen - sofern der hohe Anteil noch Unentschlossener (35% laut Forschungsgruppe Wahlen wenige Tage vor der Wahl), unentschlossen sowohl hinsichtlich einer Wahlbeteiligung als auch der Wahlentscheidung, als neutral unterstellt wird – zwei Tendenzen: eine in der Summe abnehmende Zustimmung für die beiden großen Parteien und eine anhaltende Wahrscheinlichkeit, dass sechs Parteien im neuen Landtag vertreten sein werden. Hierin könnte die diesjährige Signalwirkung für die Bundestagswahl bestehen.
Wahlstrategische Optionen und das Problem der "Ausschließeritis"
SPD und Grüne gingen in den Wahlkampf mit dem Ziel, die rotgrüne Koalition fortzusetzen. Bis Ende 2015 war diese Option durch die Umfragen gedeckt, danach wäre die Fortsetzung nur möglich gewesen, wenn AfD und DIE LINKE nicht im Parlament vertreten wären (die Piratenpartei war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr »messbar«). Seit über einem Jahr erreichen SPD und Grüne in den Umfragen nur noch 40-44%, zuletzt mit abnehmender Tendenz.
Sofern DIE LINKE den Sprung in den Landtag schaffen würde, wurde eine Zeitlang eine Rot-rot-grüne Option als möglich erachtet. Mit dem deutlichen Absinken der Grünen in den Umfragewerten sank auch diese Chance auf eine parlamentarische Mehrheit.
Ohne Aussicht auf eine parlamentarische Mehrheit waren nach den Umfragewerten alle Zweierbündnisse jenseits der Großen Koalition. Für SPD und CDU ging es angesichts dieser Stimmungslage vor allem darum, stärkste Partei zu werden und damit auch im Falle in einer möglichen Großen Koalition die Richtlinienkompetenz beanspruchen zu können.
Die kleinen Parteien reagierten auf diese von den beiden führenden Parteien geschaffene strategische Ausgangslage in NRW gänzlich anders als in Schleswig-Holstein. Während dort farbenpolitische Offenheit grundsätzlich bestand und auch nach der Wahl besteht, agierten an Rhein und Ruhr FDP und Grüne identitätspolitisch in dem Glauben, dass Erkennbarkeit etwas mit dem Ausschluss bestimmter Bündnisse zu tun habe. Die FDP schloss ein Bündnis aus, in dem auch die Grünen vertreten seien, also eine Ampel-Koalition und eine Jamaika-Koalition, ein Bündnis mit der SPD bezeichnet Lindner als »sehr unwahrscheinlich« (also nicht völlig ausgeschlossen). Die Grünen wiederum sahen sich angesichts des bedrohlichen Abwärtstrends in den Umfragen zu einem klaren Bekenntnis genötigt, für eine Koalition unter Führung der CDU nicht zur Verfügung zu stehen.
Darüber hinaus schloss auch die SPD wiederum eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei aus.
Politik durch Minderheitsregierung statt regressiver "Ausschließeritis"
Allein die Linkspartei erklärte, sie könne sich eine Tolerierung einer rotgrünen Minderheits-Regierung wie von 2010 bis 2012 praktiziert vorstellen. Das ist bemerkenswert in mehrfacher Hinsicht. Zum einen konterte DIE LINKE dadurch den durchsichtigen Versuch der SPD, die Partei durch Funktionsverlust in einer zugespitzten Landtagwahl aus dem Landtag heraushalten zu wollen. Darüber hinaus erklärte sie, der die Ministerpräsidentin notorisch Regierungsunfähigkeit vorwarf, sich bereit, an der Regierungsbildung - wenn auch indirekt - mitzuwirken.
Und last but not least: Wenige Monate vor der Bundestagswahl setzte DIE LINKE ein politisches Zeichen: die Minderheitsregierung ist ein wirksames Instrument der Regierungsführung und keineswegs zwangsläufig instabil.
Minderheitsregierungen sind, anders als insbesondere in den skandinavischen Ländern, in Deutschland untypische Regierungskonstellationen und so ist in den rund 65 Jahren deutschen Länderparlamentarismus der Nachkriegszeit auch erst zu zehn Minderheitsregierungen gekommen, von denen nur eine einzige, die Regierung Höppner (SPD) in Sachsen-Anhalt, über zwei Wahlperioden im Amt war.
Für die Deutschen ist, wie Switek darlegt, „(Regierungs-)Stabilität ein hohes Gut, weshalb die Parteien einerseits nur ungern neue Experimente wagen und andererseits ‚wacklige‘ Konstruktionen, die ein ständiges Suchen nach Mehrheiten erfordern, von Medien und Wahlbevölkerung kritisch beäugt werden“. (Switek 2011: 2)
So überraschte es nicht, dass nach rund einem Monat erfolglosen Sondierungen, zumeist gemeinsam von SPD und Grünen mit anderen Parteien, aber phasenweise auch zwischen SPD und CDU, die SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft zu resignieren begann und am 12. Juni 2010 sowohl Neuwahlen als auch eine Minderheitsregierung ausschloss, um statt dessen eine geschäftsführende schwarz-gelbe Regierung aus der Opposition heraus unter Druck zu setzen. (vgl. Feist/Hoffmann 2010: 785)
Nachdem gegen diese Haltung jedoch sowohl die Grünen als landespolitischen Erwägungen und die SPD-Bundesspitze mit Blick auf die Überwindung der absoluten Mehrheit von schwarz-gelb im Bundesrat opponierten, schwenkte Frau Kraft fünf Tage später ein und erklärte, für ein Minderheitskabinett zur Verfügung zu stehen. Nur einen Tag später bot DIE LINKE an, bei Abstimmungen unterstützend zur Verfügung zu stehen und weitere drei Tage später begannen die Koalitionsverhandlungen, die am 6. Juli 2010 abgeschlossen wurden, so dass am 14. Juli des Jahres die Ministerpräsidentin Kraft im zweiten Wahlgang mit einfacher Mehrheit unter Stimmenthaltung der LINKEN gewählt werden konnte.
Nach Grunden setzen Minderheitsregierungen, wollen sie stabil handeln können, vier allgemeine Rahmenbedingungen voraus, von denen drei für NRW interessant sind (Grunden 2011: 3f.):
1) Eine einigungsunfähige Opposition: Diese Bedingung war gegeben, denn die programmatischen Differenzen zwischen CDU und FDP einerseits sowie der LINKEN andererseits schlossen die Einigung auf eine alternative Regierungsmehrheit ebenso aus, wie punktuelle Abstimmungen in bedeutenden Fragen, die das Minderheitenkabinett gezwungen hätte, eine gegen sie gerichtete Agenda ausführen zu müssen.
2) Eine Policy-Zentrierung des Parteienwettbewerbs: Auch diese Voraussetzung war insoweit erfüllt, als es rot-grün, zumindest für knapp die Hälfte der Wahlperiode, in wichtigen Fragen regelmäßig gelang einzelne Parteien aus dem Oppositionsblock herauszulösen und dadurch Mehrheiten zu erzeugen.
3) Eine starke Kohäsion des Regierungslager: Den regierungstragenden Parteien fehlte im Parlament nur eine einzige Stimme zur Mehrheit, woraus sich bereits eine vergleichsweise günstige Ausgangsposition für das Minderheitenkabinett ergab, das zudem durch ein vertrautes Verhältnis der Spitzenpolitiker/-innen geprägt wurde und in den notwendigerweise kontinuierlich zu eruierenden Handlungsspielräumen auch nicht durch aufwendige Koalitionsverfahren eingeengt wurde.
Dem ersten Kabinett Kraft, das als Minderheitsregierung gebildet wurde, standen damit nach der Regierungsbildung 2010 Rahmenbedingungen zur Verfügung, die ein Regierungshandeln bis zum Ende der Wahlperiode denkbar gemacht hätten. Dass die Regierung während der Haushaltsberatungen 2010 an einem Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtages, zur Frage der Zustimmungserfordernis zum Haushalt in der zweiten Lesung "scheiterte", ist insofern ein unglückliches Ende dieses Lehrstücks in landesparlamentarischer Demokratie und zeigte damals vor allem auf die parlamentarische Unerfahrenheit der Linkspartei und einen unerhörten Dogmatismus der FDP.
Von der Minderheitsregierung Höppner in Sachsen-Anhalt, bekannter als das »Magdeburger-Modell«, unterschied sich die Regierung Kraft vor allem dadurch, dass sie stets auf eine Äquidistanz zu den drei Oppositionsparteien beharrte und nicht, wie Höppner, auf die Unterstützung durch eine Oppositionspartei orientierte. Einschränkend muss dazu gesagt werden, dass Höppner auch nicht die Auswahl zwischen drei potenziell unterstützungsbereiten Parteien zur Verfügung stand und darüber hinaus die Tolerierung durch die PDS eine Art Vorstufe der Regierungsbeteiligung war, die 1994 noch nicht denkbar gewesen wäre – vergleichbar mit NRW und der LINKEN 2010.
Darüber hinaus wurde durch Kraft/Löhrmann die Minderheitsregierung als eine Möglichkeit gesehen, aus der Not eine Tugend zu machen – ein Modellcharakter sollte diesem „Betriebsunfall“ verhinderter Mehrheitsbildung jedoch zu keinem Zeitpunkt zugestanden werden, weshalb eine Debatte darüber, ob NRW ein Vorbild für eine neue Spielart der Regierungsbildung im unüberschaubare werdenden Länderparlamentarismus sein könnte, weder von der Landesregierung noch den Landesparteien angestoßen oder geführt wurde.
Anzunehmen ist deshalb auch, dass im unwahrscheinlichen Fall, nach der Landtagswahl käme erneut keine mehrheitsfähige Regierungskonstellation zustande, die Bildung eines Minderheitenkabinetts als die schlechteste Lösung betrachtet und so weit wie möglich ausgeschlossen werden würde.
Regressive »Ausschließeritis«
Dies wäre freilich ein Fehler. Die Rückkehr der »Ausschließeritis« als wahlstrategisches Element zeugt von mangelnder politischer Souveränität. Die letzten Meter des Wahlkampfes in NRW waren geprägt von wahlstrategischer Identitätspolitik der Parteien. Zurecht schreibt Heribert Prantl:
»Die Ausschließeritis gehört zu den Torheiten der Politik. Die Wahlkampf-Erklärungen, dass man eine bestimmte Koalition nach der Wahl ausschließe oder nicht ausschließe – sie gleichen dem Trommeln auf leeren Töpfen. Das ist laut, das macht Krach, das erregt Aufsehen. Aber am Wahltag wird der Topf gefüllt; und dann müssen die Parteien gemeinsam daraus löffeln. (…) Ausschluss, Nichtausschluss, Halbausschluss – all solche Erklärungen sind nicht nur unklug, sondern undemokratisch. Es gehört zur Geschäftsgrundlage demokratischer Politik, dass notfalls jede einigermaßen bewährte Partei mit jeder anderen einigermaßen bewährten Partei koalieren kann. Koalitionen sind keine Hochzeiten im Politikparadies, sondern schlicht Zweckbündnisse auf Zeit. Ausschlussbekenntnisse erschweren das demokratische Geschäft.« (Süddeutsche Zeitung, 12. Mai 2017, S. 4)
Legt man das Puzzle aus den einzelnen Aussagen zusammen und gleicht es mit den Umfragen ab, so lautet das Signal an die Wählerinnen und Wähler: Wenn ihr am Ende eine Regierung bekommt, dann wird es eine Große Koalition sein.
Was wahlstrategisch in den Augen der jeweiligen Partei zielführend, weil stimmenmaximierend, sein kann, wirkt demokratiepolitisch eher regressiv. Mit den Worten von Horst Kahrs: "Unterscheidbarkeit nicht mehr durch politische Inhalte und Kompromisslinien kommuniziert wird, sondern durch rigide Abgrenzung. Parlamente werden aber gewählt, damit gewählte Parteien anschließend eine Regierung bilden bzw. sich in die Rolle von Regierung und Opposition teilen. Wenn sich nicht mehr zwei Lager gegenüberstehen, die um die Mehrheit ringen, sondern mehrere Koalitionsoptionen offen sind, führt die Ausschließeritis dazu, dass es am Ende entweder eine Partei gibt, die sich »unglaubwürdig« macht (Ypsilanti-Effekt), oder aber eine Große Koalition als Notlösung gebildet wird."
Robert Habeck kommentierte die Ausschluss-Beschlüsse der Parteifreunde: »Bei uns haben wir nichts ausgeschlossen. Wir können jetzt Politik machen.«
Kurzum: Eine Minderheitsregierung in NRW nach der Wahl könnte gemäß der Vorbildwirkung für den Bund eine spannende Erweiterung der Optionspalette darstellen und Politik ermöglichen, die nicht im kleinsten gemeinsamen Nenner erstickt.
Dieser Text entstand im Rahmen der Publikation desWahlnachtberichtes zur Landtagswahl in NRW am 14. Mai 2017 gemeinsam mit Horst Kahrs.