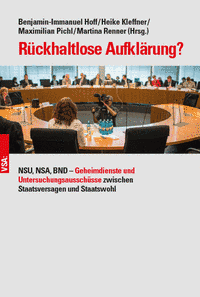Bundespräsidentenwahl 2010 – Kein rot-rot-grünes Projekt
Analyse des Bundesvorstandes des »forums demokratischer sozialismus« (fds) in der LINKEN
Die Geschichte der linken Parteien ist reich an Mythen. Legendär sind die verpassten Chancen ihrer Zusammenarbeit – insbesondere in Deutschland. Mit der Bundespräsidentenwahl 2010 ist dem Mythen- und Legendenschatz ein weiteres Element hinzugefügt worden: Gauck scheiterte, weil die LINKE nicht willens oder in der Lage war, sich für eine Regierungsoption zu entscheiden. Diese monokausale Sichtweise zu kritisieren und ein schiefes Bild in die richtige Positur zu bringen ist gerade aus Sicht derjenigen von Bedeutung, die innerhalb der LINKEN für einen unverkrampften und strategisch offenen Blick auf rot-rot-grüne Bündnisse eintreten.
Schwarz-Gelb: Bündnis ohne Rückhalt
Der Deutschland-TREND von Infratest-dimap, erhoben zwischen dem 30. Juni und 1. Juli 2010, spricht eine deutliche Sprache: 79% der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, nur 19% sind zufrieden. Dies ist der zweitniedrigste Wert seit Antritt der schwarz-gelben Koalition im vergangenen Herbst.
Knapp zwei Drittel der Befragten (62%) gehen davon aus, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung nicht mehr lange halten wird. Unter anderem weil mehr als drei Viertel (79%) die Auffassung vertreten, dass die Kanzlerin und Parteivorsitzende der CDU, Angela Merkel, ihre Koalition nicht mehr im Griff habe.[1]
Es ist in den vergangenen Monaten immer wieder in einer Mischung aus Faszination und Grauen in Medien und insbesondere bürgerlicher Öffentlichkeit diagnostiziert worden, wie dieses schwarz-gelbes Wunschbündnis in solcher Art die eigene Legitimation und Vertrauen in Handlungsfähigkeit untergraben konnte. Das Bündnis aus Union und FDP ist kein Traumpaar, sondern ein Zweckbündnis zur Sicherung politischer Macht.
Zu bezweifeln ist, dass diese Koalition derzeit die Kraft zu einem inhaltlichen oder politischen Befreiungsschlag aufbringt. Gleichzeitig ist zu konstatieren: Die Mehrheit beim Willen zum Regieren steht, wenn es Spitz auf Knopf steht. Keine Stimme mehr aber auch keine zu wenig.
Rot-Grün: Fragile Renaissance ohne Mehrheit
Wer SPD und Grüne in diesen Tagen betrachtet und ausklammert, dass für Regierungsmehrheiten in Deutschland immer noch mehr als 50% Zustimmung im Parlament und bei Wahlen benötigt werden, könnte denken, dass schwarz-gelb sich irrtümlich an der Regierung befände.
Die Zusammenarbeit von SPD und Grünen funktioniert derzeit gut. Von „wiederentdeckter Liebe“[2] und rot-grüner Renaissance ist allenthalben die Rede. Die NRW-Wahl mit dem nur knapp verpassten rot-grünen Wahlsieg und die Woge der Zustimmung für den rot-grünen Bundespräsidentenkandidaten Gauck lassen die rot-grünen Parteien derzeit deutlich aufgeräumter erscheinen als die schwarz-gelbe Koalition.
Bedauerlicherweise geraten dabei offene strategische Fragen und Widersprüche aus dem Blick. Sie zu beantworten wäre Aufgabe von SPD und Grünen. Die Form, wie beide Parteien ihrer Beantwortung aus dem Weg gehen und statt dessen die Politik- und Regierungsfähigkeit der Linken anzweifeln erinnert an den Dieb, der mit dem Finger auf einen Unbeteiligten weisend „haltet den Dieb“ ruft und sich aus dem Staub macht.
Die neue Romanze aus SPD und Grünen ist weniger für die Grünen aber umso mehr für die SPD überlebenswichtig. Nur mit den Grünen kann Sigmar Gabriel glaubhaft eine potentielle Regierungsoption präsentieren. Auch wenn dieses Bündnis weder in NRW noch im Bund über eine eigene Gestaltungsmehrheit verfügt. Für die Grünen bietet das Bündnis Risiko und Chance zugleich. Gefragt nach den politischen Präferenzen spricht sich ein absolut überwiegender Teil der grünen Mitgliedschaft für eine Zusammenarbeit mit der SPD statt mit der Union aus. Umso entspannter können die grünen Führungskräfte deshalb mit der SPD kuscheln und gleichzeitig ihre Offenheit zu allen demokratischen Parteien betonen und ausdrücklich Bündnisse mit der CDU einschließen. Gerade von denen möchte die SPD die Grünen durch öffentlichkeitswirksame Umarmungen und politische Erfolge, wie die Gauck-Kandidatur, jedoch sukzessive abdrängen.
Für ein erfolgreiches Abdrängen fehlt der Sozialdemokratie jedoch die Kraft, wirft man einen Blick in die Länder. Im Land Berlin halluzinieren die Grünen sich bereits als stärkste Regierungspartei und fordern die Spitzen von SPD und CDU auf, sich zu erklären, ob sie im kommenden Jahr auch unter Führung der Grünen in die Regierung einzutreten bereit wären. In keinem Bundesland ist die SPD noch stark genug, um nach 2010 allein zu regieren. In vielen westdeutschen Landtagen ist sie auf die Unterstützung der Grünen und eines dritten Partners angewiesen, um jenseits eines Bündnisses mit der CDU regierungsfähig zu sein.
Insoweit steht Nordrhein-Westfalen für das ambivalente Bild, dass die SPD derzeit abgibt. Nach der Landtagswahl in NRW konnte sich die Partei als Wahlsiegerin fühlen. Sie lag am Ende des Wahlkampfs gleichauf mit der CDU. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass sie freilich gegenüber der dramatischen Wahlniederlage von 2005 nochmals an Stimmen und Prozenten verloren und erneut das schlechteste Ergebnis seit 1957 erreichte.[3]
Trotz Negativrekorden stellte die NRW-Wahl eine Bestätigung der neuen SPD-Führung dar. Das Tief der Bundestagswahl wurde vorerst überwunden und mit dem überraschenden Rücktritt von Bundespräsident Köhler sowie dem Schachzug, dem bürgerlichen schwarz-gelben Kandidaten einen ebenso bürgerlichen rot-grünen Kandidaten gegenüberzustellen, fiel Gabriel ein politischer Erfolg in den Schoß, wie eine reife Frucht. Gerade deshalb ist immer wieder daran zu erinnern, dass es sich bei der neuen Stärke der SPD in Wahrheit um eine Fiktion handelt. Die SPD steht zwar besser dar als 2009 – sie ist aber ein Scheinriese.
In Summa ist Rot-Grün derzeit nicht mehr als ein fragiles Zweckbündnis. Geeignet um Aufmerksamkeit zu erregen, jedoch ohne Inhalte und attraktiv nicht aus eigener Kraft, sondern aufgrund der dramatischen Schwäche von schwarz-gelb. Es erstaunt schon, dass bislang niemand die Frage gestellt hat, was eine rot-grüne Regierung eigentlich anders machen würde, als bis zum Herbst 2005 und in den beiden Parteien auf eine eigenständige Thematisierung dieses naheliegenden Angebots an die Wählerinnen und Wähler verzichtet wird.
Rot-grüne Orientierung auf die Mitte statt nach links
Vor diesem Hintergrund und angesichts der wütenden Vorwürfe seitens SPD und Grünen an die LINKE sind die strategischen Implikationen des rot-grünen Agierens im Vorfeld und Nachgang der Bundespräsidentenwahl zu betrachten.
Der unerwartete Rücktritt von Horst Köhler gab Sigmar Gabriel, Jürgen Trittin und Renate Künast die Gelegenheit, sich die Schwäche von Ansgela Merkel zu Nutze zu machen. Von Merkel war eine sehr schnelle Entscheidung über die Kandidatur nicht zu erwarten, da sie angesichts des Rückzugs von Roland Koch als Ministerpräsident unbedingt dessen Einzug in das Bundeskabinett verhindern musste und da sie insgesamt zu zögerlichen Entscheidungen neigt.
Da die Zusammensetzung der Bundesversammlung die Mehrheitsverhältnisse im deutschen Parteiensystem abbildet, war zudem klar, dass die schwarz-gelbe Koalition ihren Kandidaten würde durchsetzen können. In einem Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Opposition von SPD und Grünen dies genauso gesehen hätte, wenn sie in der Regierungsmehrheit gewesen wäre:
„Da sie dies nicht ist und weil die veröffentlichte Meinung schon lange predigt, die bürgerliche Koalition befinde sich in einer miesen Lage, galt sogleich die Devise, der ungeliebten Kanzlerin auch bei der Präsidentenwahl eins auszuwischen. Der Applaus eines nicht geringen Publikums war ihr gewiss. Ihr Kandidat, ein zu Recht hochgeachteter Bürgerrechtler aus der ehemaligen DDR, schien der ideale Keil zu sein – sympathisch, gescheit, von menschlicher Wärme, gezeichnet von vielen Entbehrungen, mit untadeliger Biografie.“ [4]
Angesichts der Zerwürfnisse in der schwarz-gelben Koalition einerseits und der klaren Mehrheit in der Bundesversammlung für Union und FDP andererseits bestand für SPD und Grüne keinerlei Notwendigkeit, einen rot-rot-grünen Kompromisskandidaten resp. eine -kandidatin zu suchen. Viel attraktiver und strategisch wertvoller war es demgegenüber, mit einem Kandidaten Gauck unzufriedene Unions-Wahlleute anzusprechen und darüber hinaus als SPD Offenheit in Richtung FDP zu demonstrieren. Also nach dem Vorbild der Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten, die Bundesversammlung 2010 als eine Aufwärmübung, ein Signal in Richtung Ampelkoalition zu initiieren. Da der LINKEN im Zweifel außer SPD und Grünen keine Regierungspartner zur Verfügung stehen und die FDP sich seit der Landtagswahl in NRW in Lockerungsübungen gegenüber rot-gelb-grünen Bündnisüberlegungen befindet, war diese Überlegung logisch und nachvollziehbar, auch wenn sie naturgemäß nicht laut ausgesprochen wurde. Der hessische SPD-Fraktionsvorsitzende Schäfer-Gümpel bestätigte dies nach der Bundesversammlung gegenüber der taz:
„Wir waren nicht auf der Suche nach einem rot-grün-roten Kandidaten. Der hätte doch gar keine Mehrheit gehabt. Uns ging es um jemanden, hinter dem sich alle Parteien versammeln können. Das Ziel war auch nicht, die Linkspartei zu beeinflussen.“[5]
Die Widerstände innerhalb der FDP gegenüber dem Kandidaten Wulff zeigten die Richtigkeit entsprechender Überlegungen. Die SPD erschien anschlussfähig gegenüber den Liberalen – ein Ziel, dass Steinmeier schon länger und Gabriel seit vergangenem Jahr verfolgt und der bislang die intime Feindschaft der beiden im selben bürgerlich-liberalen urbanen Milieu fischenden Parteien, FDP und Grüne, entgegenstand.
Für diesen Zweck waren SPD und Grüne auch bereit in Kauf zu nehmen, dass Joachim Gauck in vielem das pure Gegenteil von dem vertrat, was in den Programmen der beiden Parteien steht und in der Mehrheit der Mitgliedschaft gedacht wird. Und da lange Zeit von einer Nichtwahl Gaucks auszugehen war, musste auch nicht erläutert werden, wie inkompatibel das Weltbild Gaucks mit dem Gesellschaftsmodell der beiden rot-grünen Parteien ist. Die NZZ fasst dies im gleichen Kommentar wie folgt zusammen:
„Joachim Gauck ritt bald auf einer Woge der Sympathie und fand in den Medien begeisterte Wasserträger, während sich das Regierungslager von der Opposition gar vorhalten lassen musste, mit seinem Vorschlag einen reinen Parteienschacher betrieben zu haben. Auch dieser dialektische Meisterstreich schlug voll ein und fand ein enormes Echo. Hier der Held des ostdeutschen Freiheitskampfes, da der blasse Parteisoldat aus der niedersächsischen Provinz, ein Knappe im Sold der kargen Kanzlerin, die doch endlich die Wahl «freizugeben» hätte. (…)
Mit der Kandidatur Gauck ist Schindluderei betrieben worden, ein durchsichtiges und falsches Spiel im Kampf um Schlagzeilen und Quoten. Und nie hätte die rot-grüne Opposition diesen «Geniestreich» gewagt, wäre sie an der Macht gewesen.“[6]
Mit dem Vorwurf gegenüber der LINKEN, die Wahl von Gauck verhindert zu haben, soll dieser Geniestreich nun veredelt werden. Verkannt wird dabei, dass die Aufstellung von Luc Jochimsen als Bundespräsidentin-Kandidatin der LINKEN das legitime Recht der zweitstärksten Oppositionspartei im Bundestag ist und zugleich logische Reaktion auf die Orientierung von SPD und Grünen auf Signale in Richtung bürgerliche Mitte.
Ausgeblendet wird jedoch insbesondere, dass Jochimsens Kandidatur im ersten und zweiten Wahlgang erst die Plattform der schwarz-gelben Dissidenten war und damit zum tatsächlichen Erfolg bei der Strategie, Merkel durch möglichst viele Abweichler von schwarz-gelb zu schwächen. Einen realistischen Erfolg hatte Joachim Gauck gleichwohl nicht. Bereits im zweiten Wahlgang hatten 615 Stimmen für Wulff und 613 Stimmen für das heterogene Nicht-Wulff-Lager aus SPD, Grünen, Linken, Freien Wählern und Rechtsextremen verdeutlicht, dass eine Mehrheit für Gauck selbst bei vollständiger Zustimmung der LINKEN nicht zu erreichen gewesen wäre.
Widersprüche in der LINKEN
In der taz weist Bettina Gaus darauf hin, dass entgegen der veröffentlichten Meinung und den Vorwürfen von SPD und Grünen, das Abstimmungsverhalten der LINKEN rational war und nicht in den Kategorien unbewältigter SED-Vergangenheit zu behandeln ist:
„SPD und Grüne tun so, als ob sie einen verbrieften Anspruch darauf hätten, dass die Linke ihnen jederzeit als Mehrheitsbeschafferin zur Verfügung steht. Darin werden sie von zahlreichen Medien bestärkt. Dennoch ist es ein Irrtum.
Die Linke ist eine eigenständige Partei, die - wie alle anderen auch - jede gesetzlich zulässige Position vertreten darf, sogar blanken Unfug. Joachim Gauck nicht gewählt zu haben war seitens der Linken kein Unfug, sondern eine Konsequenz, die sich zwingend aus den jeweiligen Standpunkten ergab. Außenpolitisch und sozialpolitisch könnten die Gräben tiefer nicht sein.
Wer angesichts dessen meint, aus der Ablehnung von Gauck ein ungeklärtes Verhältnis zur Stasi ableiten zu können, argumentiert entweder demagogisch oder zeigt, dass er Inhalte in der Politik für bedeutungslos hält und ihn allein die koalitionäre Farbenlehre interessiert.“[7]
Dem ist zuzustimmen. SPD und Grüne beabsichtigten nicht, wie gezeigt wurde, mit der Kandidatur von Joachim Gauck ein politisches Signal in Richtung einer rot-rot-grünen Politikalternative zu senden und Gauck wäre, selbst wenn dies intendiert gewesen wäre, dazu weder bereit noch in der Lage gewesen. Gleichzeitig wie selbstverständlich anzunehmen, dass die LINKE automatisch die Westentaschenreserve einer fehlenden rot-grünen Gestaltungs- und Entscheidungsmehrheit ist, basiert auf einem Irrtum. Dies ist umso ärgerlicher, weil sich gerade die Grünen mit ihrer Strategie der Äquidistanz zu SPD und Grünen von solchen machtpolitischen Block-Phantasien der SPD zu emanzipieren suchen.
Angesichts dieser Konstellationen war es zwingend geboten, mit der souveränen Entscheidung für eine eigene Kandidatin unsere eigenen Schwerpunkte und unsere politische Haltung als LINKE zu präsentieren. Weil SPD und Grüne erkennbar zeigten, dass sie anders als bei der Kandidatin Gesine Schwan nicht um die Zustimmung der LINKEN werben, die Nichtzustimmung aber zu einem Gradmesser der Politikfähigkeit der LINKEN instrumentalisieren würden, präsentierten wir mit Luc Jochimsen eine respektable und würdige Kandidatin. Diese Ernsthaftigkeit und die Person wurden in der Öffentlichkeit honoriert. Dies war bekanntermaßen nicht immer so.
Ist das strategische und taktische der LINKEN vom Rücktritt Köhlers bis zum Abschluss des 3. Wahlgangs der Bundesversammlung gleichwohl richtig oder gar ein Erfolg?
Mit der Benennung von Luc Jochimsen erschöpfte sich das wahrnehmbare strategische Handeln der LINKEN. Auf die wachsende Zustimmung für Joachim Gauck und die zu erwartende Frage, wie sich die LINKE in einem möglichen dritten Wahlgang verhalten würde, wurde mit widersprüchlichen, zum Teil haltlosen Vorwürfen gegenüber der Person Joachim Gauck reagiert. Die tatsächliche Differenz zu Gauck, anhand derer zugleich die Widersprüche zwischen Gauck und den beiden rot-grünen Parteien hätten offenbart werden können, gingen stattdessen in politischer Folklore unter.
Im Hype um Gauck musste durch uns als LINKE nicht wirklich die Frage beantwortet werden, ob und warum wir trotz aller Widersprüche zu Gauck bereit wären, im Falle eines 3. Wahlganges durch dessen Nichtunterstützung implizit die Wahl eines ebenso konservativen Kandidaten wenn nicht zu befördern, dann zumindest nicht zu erschweren. Ein Glück, denn auch wenn ein 3. Wahlgang allgemein als unrealistisch erachtet wurde, hätten wir darauf zwar viele verschiedene, aber möglicherweise keine ausreichende Antwort gehabt.
Die Option, flexibel zu reagieren und ernsthaft die Frage zu erörtern, welchen Preis wir für eine nachhaltige Schwächung einer schwarz-gelben Regierung zu zahlen bereit sind, blieb ungenutzt. Letztlich hätte das Ergebnis einer solchen Abwägung ja dennoch gegen Gauck sprechen können. In dem Sinne, dass die Wahl von Gauck aufgrund seiner Positionen und trotz der Schwächung Merkels ein zu hoher Preis für die Unterstützung rot-grüner Ampelträume gewesen wäre. Vielleicht hätte es dann ein nicht so einheitliches aber genauso vermittelbares Abstimmungsverhalten gegeben. Dass die Diskussion darüber nicht zustande kam, ist schlecht und weist auf Probleme im politischen Weltbild unserer Partei hin.
Die fehlende Flexibilität im Vorfeld und Verlauf der Bundesversammlung ist letztlich Ergebnis der falschen Vorstellung innerhalb eines relevanten Teils unserer Partei und der vorherrschenden Partei-Erzählung (nicht zuletzt im Entwurf des Parteiprogramms), von einem bipolaren Parteiensystem, bei dem die LINKE auf der einen Seite, einem neoliberalen Einheitsbrei aller anderen Parteien auf der anderen Seite gegenüber stünde. Der historisch gefährliche und politisch dumme Hitler-Stalin-Vergleich von Diether Dehm zeigt die absurden Dimensionen, die eine solche Fehlwahrnehmung des Parteiensystems und der politischen Lager zu zeitigen in der Lage ist.[8]
Den rot-grünen Parteien und insbesondere der SPD ist der Vorwurf zu machen, dass sie durch ihr Agieren und dem Wunsch, die LINKE zu isolieren um selbst wieder mehrheitsfähig zu werden, einer Wahrnehmung bipolarer Kräfteverhältnisse, die LINKE gegen alle, Vorschub geleistet und sich selbst einen Bärendienst erwiesen haben. Fehlende Gestaltungsmehrheit mit genialen Schachzügen ausgleichen zu wollen, an deren Ende jedoch eingeschränktere Gestaltungsoptionen stehen, macht keinen Sinn.
Stefan Liebich hat die zu ziehenden Schlussfolgerungen mit einem Satz prägnant zusammengefasst: Es muss mehr miteinander gesprochen werden. Die Oslo-Gruppe hat damit begonnen. Im Aufruf „Das Leben ist bunter“ der Oslo-Gruppe heißt es dazu:
„Ob am Ende die inhaltlichen Übereinstimmungen, der gesellschaftliche Rückhalt und der gemeinsame Wille zur Übernahme von Verantwortung eine rot-rot-grüne Mehrheit Wirklichkeit werden lassen, steht heute noch nicht fest. Wir wissen, dass es Hürden und Bedenken in jeder unserer Parteien gibt, Vorbehalte wie Vorurteile, aber eben auch inhaltliche Unterschiede. Wir haben nun den Dialog über die Möglichkeiten eines solchen Bündnisses auf Bundesebene begonnen. Und wir wollen uns auf den Weg machen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu diskutieren; nicht mehr und nicht weniger.“[9]
* * *
[1] http://www.infratest-dimap.de/uploads/media/dt1007_bericht.pdf
[2] FAZ vom 02. Juli 2010
[3] Vgl. Benjamin-Immanuel Hoff/Horst Kahrs, Die Landtagswahl in NRW 2010. Wahlnachtbericht und erste Analyse, http://www.benjamin-hoff.de/article/3542.die-landtagswahl-in-nordrhein-westfalen-2010.html
[4] Gedanken nach dem Wahltheater. Kommentar zur Bundespräsidentenwahl in Berlin, NZZ-online vom 30. Juni 2010: http://www.nzz.ch/nachrichten/international/bundespraesident_wahl_deutschland_1.6333863.html.[5] http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/die-linke-hat-eine-chance-verpasst/
[6] Gedanken nach dem Wahltheater. Kommentar zur Bundespräsidentenwahl in Berlin, NZZ-online vom 30. Juni 2010: http://www.nzz.ch/nachrichten/international/bundespraesident_wahl_deutschland_1.6333863.html.[7] Was zur Wahl stand – und steht. Kommentar von Bettina Gaus, taz, 02. Juli 2010: http://www.taz.de/1/debatte /kommentar/artikel/1/was-zur-wahl-stand-und-steht/
[8] Ein weiteres Beispiel solcher unterkomplexen Politikvorstellungen bot Werner Pirker in der Jungen Welt vom 02. Juli 2010: http://www.jungewelt.de/2010/07-02/034.php.
[9] http://blog.wawzyniak.de/wp-content/uploads/2010/07/Layout_DasLebenistbunter_Endfassung-1.pdf
Download-Dokumente:
-
Analyse des Bundesvorstandes des »forums demokratische sozialisten« (fds) in der LINKEN